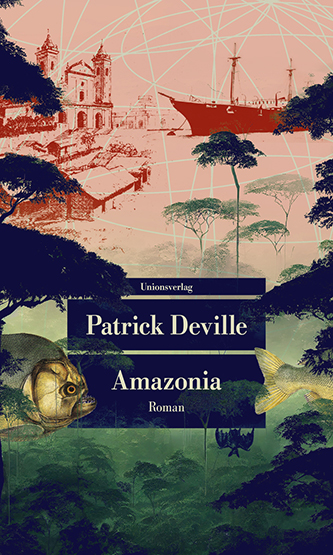Zwei junge Frauen. Der Verzweiflung schon lange nicht mehr nah – dafür haben sie beide schon zu viel in ihrem jungen Leben erlebt. Sie wissen ganz genau, dass man nicht um Hilfe rufen braucht, wenn man selbige braucht. Es kommt eh keiner zu Hilfe. Alk und Dope sind ihre einzigen Freunde, die sie vergessen lassen, was ist. Ach ja, sie haben beide getötet. Unabhängig voneinander. Die Gründe sind unterschiedlich. Die Folgen sind die gleichen: Flucht. Das Schicksal, das verdammte Schicksal, hat sie zu Weggefährtinnen gemacht. Und nun? Wäre der Roman heute geschrieben worden, wäre ihre Allianz von gegenseitiger Heilung bestimmt. Doch „Baise moi“ – der Titel hat so gar nichts von sozialarbeiterischer Seelenversorgung an sich, übersetzt heißt es „Fick mich“ – ist ein knappes Vierteljahrhundert alt und noch immer jung und ergreifend wie Ende der 90er.
Nadine und Manu sind nun also Bonnie und Clyde, Thelma und Louise, ach all die ganzen verzweifelten Paare der Geschichte, die ihr Ende einte. Doch Nadine und Manu sind mit einer schonungslosen Chuzpe ausgestattet, die es eigentlich verbietet verfilmt, veröffentlicht zu werden. Klingt drastisch, aber man stelle sich vor, dass jemand vorhat dieses Buch heutzutage noch einmal originalgetreu zu verfilmen… unmöglich. Die moralisierte Moderne hinkt sich selbst um mehr als zwanzig Jahre hinterher. Der Film, von der Autorin selbst auf die Leinwand gebracht, durfte nur in Pornokinos gezeigt werden. Höchste Jugendschutzeinstufung!
Da sind sie nun – die Täterinnen. Abenteuergierig, lebenshungrig, perspektivlos. Sie haben nur eine Wahl: Rache nehmen. An all dem, was sie zu dem werden ließ, was sie sind. Für die einen Monster, marodierende Gören, die nicht arbeiten wollen, und nur Zerstörung im Kopf haben. Für die Anderen Opfer der Gesellschaft, denen man helfen muss, weil es noch nicht zu spät ist.
Über dieser Diskrepanz schwebt der Vorwurf des Tötungsdeliktes. Die Gründe, die Hintergründe gilt es an anderer Stelle aufzuklären. All das interessiert Nadine und Manu nicht im Geringsten. Sie sind bereit ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Dass sie auf ihrem Weg Spuren hinterlassen, die Blinde nicht übersehen können, ist ihnen teils bewusst. Es interessiert sie aber nicht! Auch eine Form von Emanzipation!
„Baise Moi“ wird sicher niemals Schullektüre werden. Die expliziten Szenen von Gewalt (jeglicher Gewalt!) sind nichts für zarte Gemüter. Den Film haben sicher mehr Menschen gesehen als es eine Statistik vermag wiederzugeben. Das Buch sollten diejenigen, die den Film gesehen haben, auch unbedingt lesen. Denn es geht hier nicht um detaillierte Darstellung von Sexualität in ihrer ungeschminktesten Form (obwohl das garantiert dazu beitrug den Film so populär zu machen), es geht darum zu zeigen was Menschen in perfiden Situationen zu machen imstande sind. Die Schonungslose Sprache von Virginie Despentes ist anfangs erschreckend. Aber keines der „verbotenen“ Wörter ist eines zu viel. Nur so funktioniert dieses Buch!