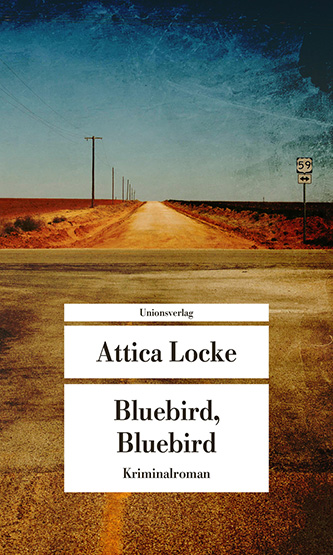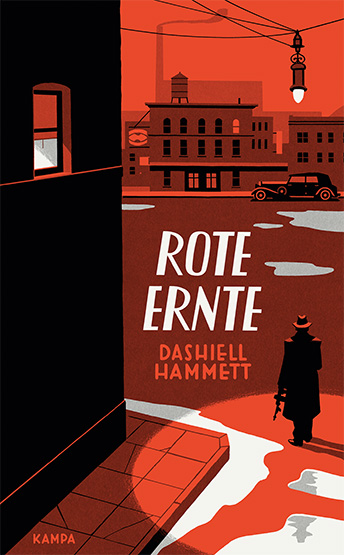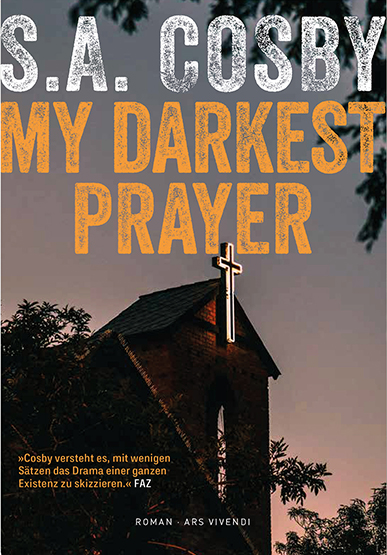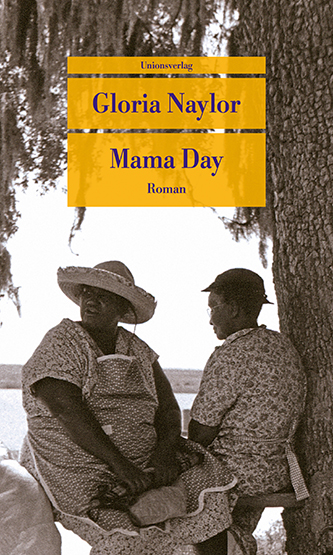Genevas Bar war schon immer hier. So scheint es. Am Highway, wo sich Trucker und Einheimische den Whiskey ihren Rachen runterlaufen lassen, wo für knapp fünf Dollar ein Sandwich den Magen wärmt, wo Geneva für die wichtige Ordnung sorgt. Sie hat ihren Sohn schon vor Langem zu Grabe getragen. Und seitdem trägt sie Trauer im Herzen, ohne daraus eine Mördergrube zu machen. Die Idylle – wenn man es überhaupt so nennen darf – gerät ins Wanken als in der Nähe zwei Leichen entdeckt werden. Eine junge – weiße – Frau. Und schon werden im Umkreis von ein paar Meilen alle – schwarzen – Männer erstmal verhaftet, zumindest sehr genau unter die Lupe genommen. Kurz zuvor wurde die Leiche eines – schwarzen – Mannes gefunden. Da herrschte bei den Cops noch Routine. Geneva weiß, dass bald schon Aufruhr herrschen wird im Osten von Texas.
Texas Ranger Darren Mathews muss die Morde aufklären. Besser heute als morgen. Denn je länger die Untersuchungen andauern, desto mehr brodelt die Gerüchteküche. Schuldzuweisungen machen nicht nur die Runde, sie werden lauter und lauter. Und Mathews hat auch schon einen Verdacht: Die arische Bruderschaft hat irgendwie ihre brauen Finger im mörderischen Spiel. Das laut auszusprechen, birgt für ihn aber große Gefahren. So was sagt man nicht laut, wenn man keine stichhaltigen Beweise hat und schon gar nicht wenn man als Einzelkämpfer für Gerechtigkeit zu sorgen hat. Und erst recht nicht, wenn man seine Hautfarbe hat…
Mathews ist aber auch ein Ehrenmann mit festen Prinzipien. Die haben ihm seine Verwandten eingeimpft. Niemals einen Anlass zur Beschwerde geben. Äußerlich, aber auch innerlich immer korrekt sein. Er trägt den Stetson wie selbstverständlich, seine Kleidung ist stets gepflegt. Und sein Gewissen ist rein. Seine Vorgehensweise unermüdlich gewissenhaft. Das hilft ihm aber auch nicht weiter als er seine Nachforschungen zum Tod der gefundenen Leichen beginnt. Man ist höflich zu ihm – noch. Man antwortet exakt auf das, was er fragt. Aber nur so viel wie nötig. Die so genannte Mauer des Schweigens scheint für Mathews unüberwindbar. Aber wer sich in Sicherheit wiegt, hat in Texas Ranger Darren Mathews einen unerbitterlichen Gegner.
Selten zuvor hat es eine Autorin geschafft derart rasant den Leser in eine Geschichte hineinzuziehen wie Attica Locke. Schon nach wenigen Zeilen sieht man den Film vor seinen Augen: Den gleichgültigen Bayou, die verzweifelten Bewohner mitten im Nirgendwo im Osten von Texas, die immer gleichen Gesprächsfetzen in Genevas Bar, der unterschwellige und der offene Rassismus, die verlorenen Seelen, die Einöde, die Normalität, die zu zerbrechen droht, weil zwei Menschen unterschiedlicher Hautfarbe tot aufgefunden wurden. Das „Wer war es?“ rückt in den Hintergrund, wenn die Angst alle Regeln auf den Kopf zu stellen droht.