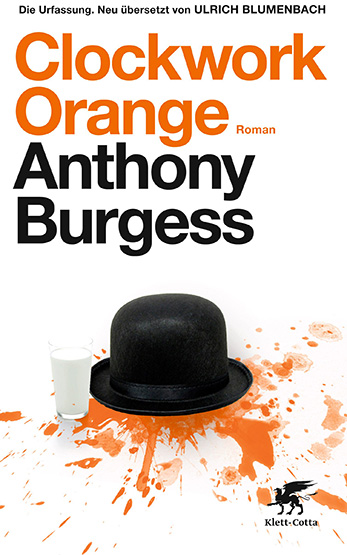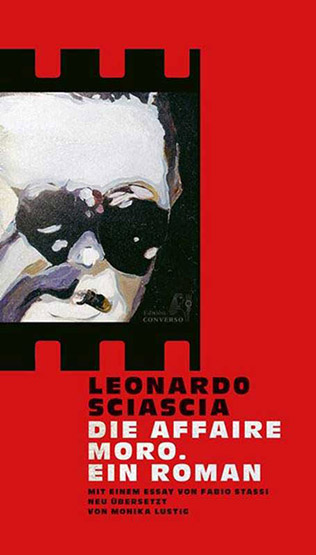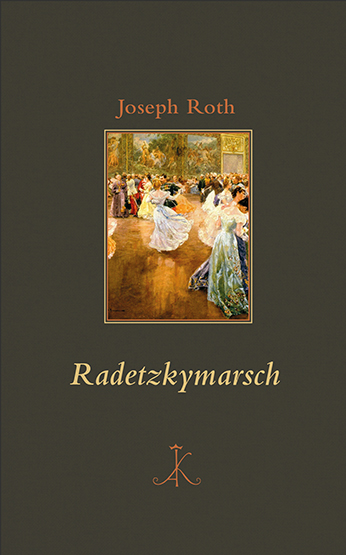Alex (15) sitzt mit seinen Freunden in einer Bar. Sie wissen nicht, was sie tun sollen. Als sie aufbrechen, wissen sie noch nicht, was sie erwartet. Ihnen liegt die Welt zu Füßen – im wahrsten Sinne des Wortes. Wie eine Horde marodierender Jugendlicher hinterlassen sie eine blutige Spur der Verwüstung. Mit geschwollenen Worten traktieren sie ihre Opfer, prügeln und vergewaltigen, was das Zeug hält. Bis der lange Arm des Gesetzes Alex, ihren Anführer, in den Würgegriff nimmt. Das Urteil: Gefängnis. Wenn er allerdings an einem Umerziehungsprogramm teilnimmt, wird er begnadigt. Alex nimmt an und erlebt eine echte Horrorshow. Kann man „Clockwork Orange“ wirklich so nüchtern betrachten? Njet!
Denn Alex und seine Droogs, seine Freunde, sind ein Produkt ihrer selbst. Sie sind die erste Generation nach dem Krieg. Sie haben nie kämpfen müssen. Sie wollen die neue Zeit genießen. Aber bitte nur die schönen Seiten! Sie haben keine Wahl, im Sinne von Auswahl. Ihre Opfer sind willkürlich auserkoren ihre Rolle zu spielen. Ihre Opfer sind keine echten Gegner. Meist sind sie so verdutzt, dass sie viel zu spät merken wie ihnen geschieht. Und selbst wenn sie vorausschauend sind, finden Alex, Dim, Pete und Georgie (die wahren Beatles?) einen Weg doch zu ihnen vor- bzw. in sie oder ihre Komfortzone einzudringen. Bei einem ihrer nächtlichen Streifzüge entdecken sie das Manuskript eines Autors, „Clockwork Orange“. Alex ist fasziniert von dem Werk. Und von der Frau des Verfassers. Und von der Idee sich mal so richtig auszutoben. Die Strafe folgt auf dem Fuße. Auch so könnte man „Clockwork Orange“ beschreiben. Aber dem eigentlichen Faszinosum „Clockwork Orange“ ist man immer noch nicht auf die Spur gekommen.
In den Schestdesiati sitzen Alex und seine Droogs gelangweilt in der Moloko-Bar. In ihrer Mira existieren keine Vorschriften. Sie tun was sie wollen. Viddieren sie etwas, was ihnen gefällt, wird es horrorshow. Bis zum bitteren Ende. Und das kommt in Person des Staates. Mit der Ludovico-Methode sollen Kriminelle eine Aversion gegen Gewalt entwickeln. Alex wird zum Vorzeige-Probanden. Ihm werden im Gefängnis Gewaltszenen vorgeführt. Ihm wird übel, dass er es nicht mehr aushält. Er fleht und winselt nach Gnade. Zur Musik von Ludwig van, der Alex verehrt, wird ihm übel wie er es sich nie vorstellen konnte. Ist Alex nun geheilt? Und was heißt es geheilt zu sein? Den freien Willen zu verlieren?
Als das Buch vor über sechzig Jahre erschien, konnte man anfangs nichts damit anfangen. Gewaltverherrlichend, brutal, unverfilmbar – das waren nur einige Schlagworte, mit denen man versuchte das Buch zu unterdrücken. Es kam anders. Ja, Gewalt spielt eine zentrale Rolle in dem Buch. Und die russischen Begriffe, die Alex und seine Droogs (drug, russisch für Freund), waren sicherlich auch nicht hilfreich im immer kälter werdenden Kalten Krieg eine massenhafte Leserschaft zu erreichen. Doch die Konsequenz, mit der Anthony Burgess – immerhin ein angesehener Autor – seinen Stil durchzieht, mit welcher Vehemenz schlussendlich über den Stoff (Was ist Freiheit? Wie nutzen wir sie? etc.) diskutiert wurde, trugen dazu bei, dass das Buch bis heute unvergleichlich ist. Den Schlusspunkt unter die Diskussion setzt unzweifelhaft Stanley Kubricks Film. Es ist völlig unerheblich der Frage nachzugehen, was den Wunsch diesen Stoff in sich aufzusaugen befriedigt, Film oder Buch? Beides. Denn wer den Filmklassiker gesehen hat, will/muss auch das Buchklassiker lesen.
Es bleibt immer die Frage im Raum stehen, was Freiheit wirklich bedeutet (und dabei muss man die Allwissenden aus den Straßenumfragen und Pseudointellektuellen ausblenden) und wie weit diese eingeschränkt wird. Wenn Opfer zu Tätern werden, ist das niemals ein Fortschritt. Dieses Buch zu lesen und anschließend den Film aufzusaugen, ist mehr als nur ein Anfang. Wofür auch immer … Schlussblende … Ende