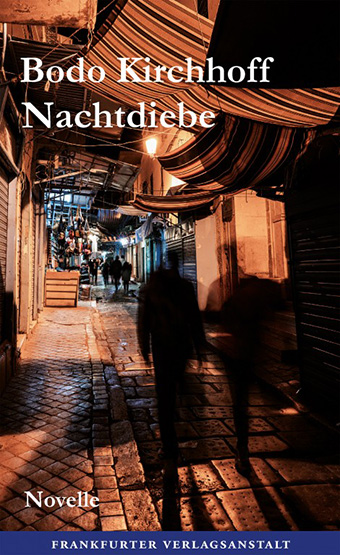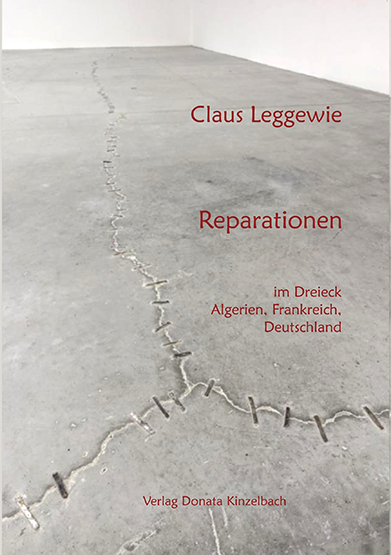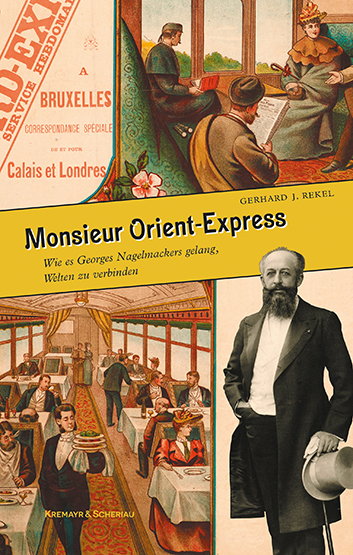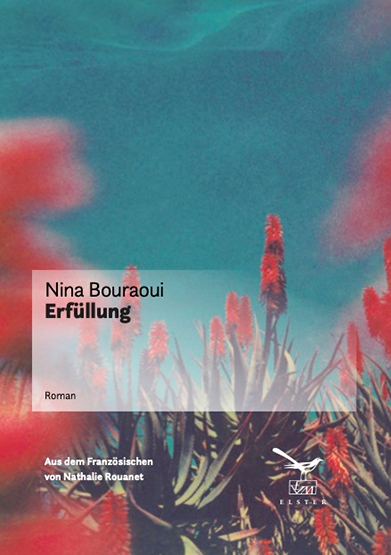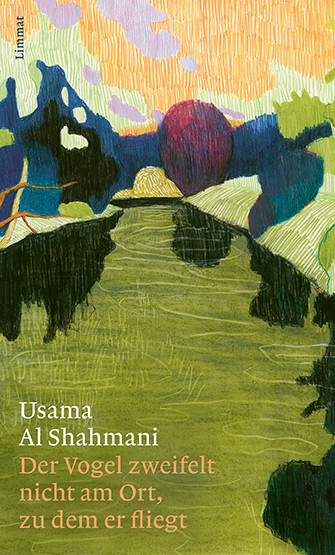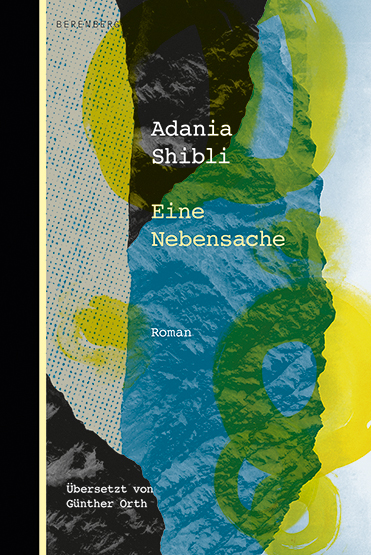Was Märchen erzählen, ist wahr! Mit dieser Einstellung wird dieses Buch zu einer Reise zu den Sternen. Die Sterne strahlen über Algerien, über das Volk der Kabylen, einem Berbervolk. Was weiß man als Allgemeinreisender, vielleicht als Vielleser schon über die Menschen, die im Nordosten Algeriens leben? Vielleicht fallen einigen wenigen ausgewählten Lesern die Namen Jean und Fadhma Amrouche ein. Nun kommt Tao Amrouche hinzu. Sie ist die Schwester von Jean und die Tochter von Fadhma.
Ihr allein fällt das Lob zu die Geschichten der Ahnen gesammelt und zu Papier gebracht zu haben. Natürlich ist es nicht wahr, dass der Geistervogel die schöne und tüchtige Tochter einer Familie auf ihren Schwingen ins Paradies holt. Aber mal ehrlich: Ein Märchen ohne Phantasie ist doch nichts als ein trüber Abklatsch der Realität. Bleiben wir doch gleich bei dem Gewittervogel. Die Tochter, Yamina, begleitet den Gewittervogel gern. Er wird sie für immer beschützen, all ihre Wünsche in Erfüllung gehen lassen. Und hier kommt das alle Märchen der Welt vereinende Element ins Spiel. Er stellt eine Bedingung. Sie wird niemals sein Gesicht sehen. Und solange sie nichts unternimmt ihren Mann, den Gewittervogel, anzuschauen, bleibt alles so wie es ist – nämlich paradiesisch perfekt. Doch nach elysischen Jahren wächst in ihr der Drang ihre Familie wiederzusehen. Wunsch erlaubt. Dreißig Tage wird sie im Schoß der Familie weilen würfen. Inzwischen ist Yamina zu einer bildhübschen jungen Frau gereift. Als der Abschied naht, lässt sie sich von ihren Geschwistern überreden eine Kerze mitzunehmen. Im Kerzenlicht soll sie das Gesicht ihres Beschützers erkennen. Der Plan misslingt. Vorbei das schöne Leben. Vorbei der Beschützer. Und das irdische Leben hält auch nur noch Enttäuschungen für sie parat. Das ist nur eine Geschichte in diesem Sammelband.
Verlagen wie dem Kinzelbach-Verlag ist es zu verdanken, dass fremde Kulturen nicht länger im Schatten verborgen bleiben oder aus irgendwelchen Gründen derart verfremdet werden, dass ihre Ursprünge kaum noch zu erkennen sind. Dieses Buch lesen die Großen den Kleinen vor, und beide empfinden den gleichen Spaß dabei. Besser geht’s nicht!