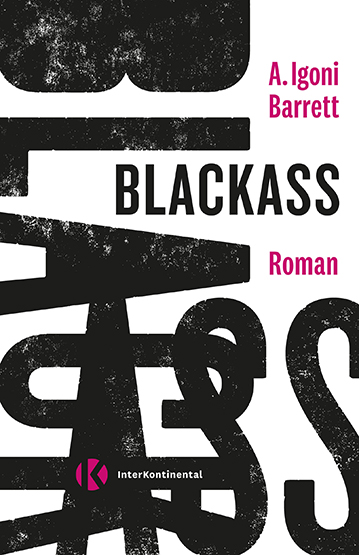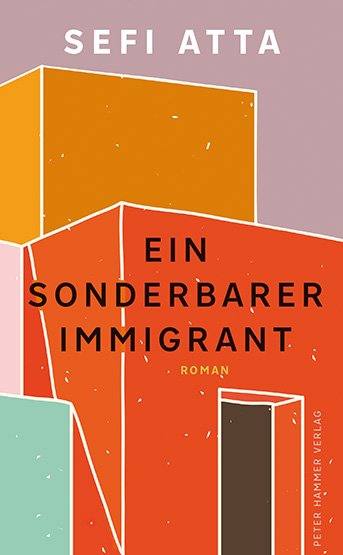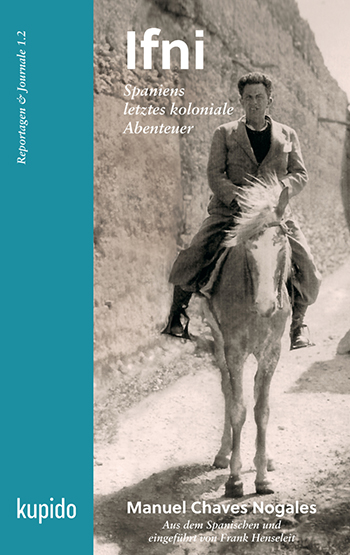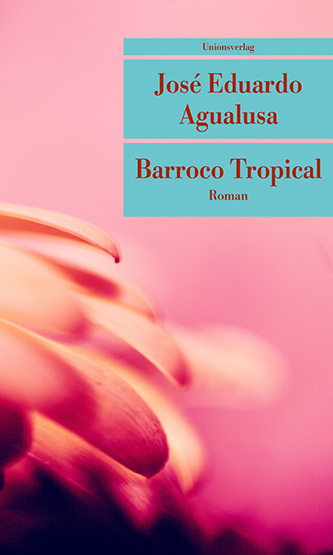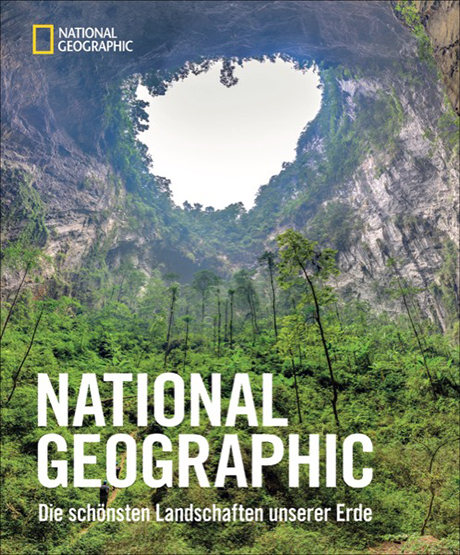Wenn von Afrika die Rede ist, rutscht man schnell in eine Argumentationskette, die einzig allein auf Armut und Elend ausgerichtet ist. Dass diese Armut und diese Elend nicht wegzudiskutieren sind, liegt ebenso auf der Hand. Dennoch lebt der schwarze Kontinent – noch so eine wunderbare Floskel, die verniedlichend, verharmlosend Afrika beschreibt. Dass wirklich einzigartige an Afrika ist, dass es auf diesem Kontinent ein relativ große Übereinstimmung gibt sich als Afrikaner zu sehen. Eine nationale Identität bildete sich erst in den vergangenen Jahren heraus.
Nicht minder sind es afrikanische Autoren, die mit ihrer an Traditionen gehefteten Schreibweise dem Kontinent in unaufhörlicher Weise Stimmen verleihen, die so vielschichtig sind, dass der Versuch sie zu zählen zum Scheitern verurteilt ist.
Bestes Beispiel dafür ist diese Geschichtensammlung aus dem Leipziger akono-Verlag. Uganda, Nigeria, Südafrika sind nur ein paar Länder, die mal kürzer, mal länger von einem Leben berichten, das voller Begehren ist. Und um es kurz zu machen: Ja, auch ums liebe Geld geht’s – ABER: Niemals nur allein, und schon gar nicht vordergründig. Treue und Liebe, Zuneigung und Verlangen, Hingabe und Verzweiflung sind die scharfen Zutaten dieser literarischen Köstlichkeiten.
Da betet eine Frau zu Gott ihr Halt zu geben und Stütze zu sein. Gerade bene lag sie noch mit ihrem Liebhaber in den Federn als plötzliche seine Frau nach Hause kommt. Wie peinlich. Voller Scham wendet sie an den, der ihr die richtige Wahl zu sein scheint. Einzig Zeit und Ort scheinen nicht die rechte Wahl zu sein…
Die Liebe ist heftig, andauernd, aber auch gefährlich und findet oft im Geheimen statt. Typisch afrikanisch? Nicht minder als anderswo. Aber nicht überall wird so offen und hemmungslos darüber geschrieben. Die Kurzgeschichten in diesem Buch brennen vor Leidenschaft. Es lodert nicht, hier sind die Feuer weithin sichtbar.