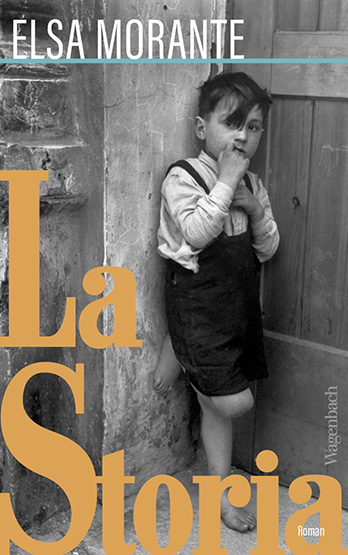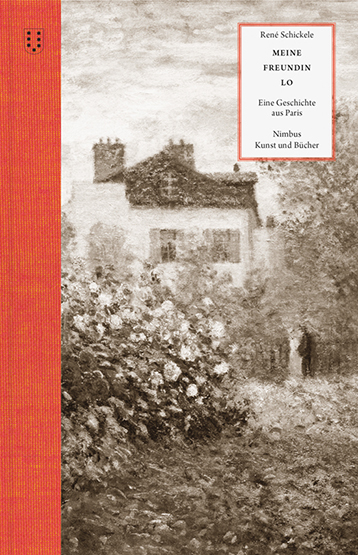Da steht man nun vor diesem Bild. „Die Venus von Urbino“, gemalt von Tizian, Mitte des 16. Jahrhunderts. Alles so rein, so frisch, ein bisschen anstößig. Wenn man an die zeit denkt, in der es gemalt wurde. Und schon springt das Räderwerk im Kopf an. Wer ist das? Wer sind die Personen im Hintergrund? Alles nur Phantasiegeschöpfe oder reale Personen?
Venedig zur Zeit Tizians. Schon früh bemerkt Angela, dass es klüger ist den Mund zu halten als sich gleich zu beschweren. Ihr Vater ermöglicht ihr eine Schulbildung. Doch ihr Lehrer ist mehr an ihren Brüsten und dem Körper interessiert als dem jungen Ding die Lektionen zu erteilen, für die er bezahlt wird. Angela erduldet es. Die Stimme der Mutter, die ihr rät still zu bleiben stets im Hinterkopf. Jahre später kommt ihr diese harte Schule zugute. Als Kurtisane – auch so ein Wort, das man heute kaum noch verwendet, mit Sicherheit wer sie heute Influencerin – hat sie sich einen respektablen Ruf erarbeitet.
Es ist ein Venedig, das vom Handel lebt. Und so ziemlich alles ist eine Ware. Informationen sind die haltbarsten Güter. Der Poet Aretino ist das Lästermaul der feineren Gesellschaft. Er weiß Dinge zu berichten … und tut es auch. Immer, wirklich immer, mit der Maßgabe selbst einen Vorteil für sich selbst herausziehen zu können. Die Wuchermieten der Serenissima zahlt er nicht! So einer hat natürlich Feinde, und die wenigen Freunde, die er hat, sich wohlweislich ausgesucht.
Dann ist da noch Fedele. Einst eine blühende Schönheit. Heute verschrobene Alte, der man lieber aus dem Weg geht, wenn man sie nicht kennt und ihr mit ihren Bücherpaketen begegnet. Doch Fedele ist gerissen. Sie hat vorgesorgt. Ihr Wissen ist fast so viel wert wie das von Aretino.
Nun hat sich Angela, La Zaffetta, kein rühmlicher Spitzname, den sie von ihrem Vater übernehmen musste, in den Kopf gesetzt ihr Leben zu ändern. Einen ihrer Stammkunden lehnt sie unverhohlen ab. Sie kann sich das erlauben, meint sie. Doch eben dieser Lorenzo Venier ist ein enger Freund von Aretino. Und den hat man lieber nicht zum Feind. Ein kurzes No und die Welt von La Zaffetta wird nie wieder dieselbe sein…
Lea Singer gibt in ihrem historischen Roman „La fenice“ der Geschichte eine gehörige Portion Geschichte hinzu. La Zaffetta, Aretino und Venier – die gab es alle tatsächlich. Sie prägten Venedig Mitte des 16. Jahrhunderts. Und Angela aka La Zaffetta wurde sogar von Tizian verewigt. Beim Lesen kommt niemals die Frage auf, ob denn nun wirklich alles sich genauso zugetragen hat. Das ist auch nicht wichtig. Die Sprachwucht, die keinerlei Zweifel aufkommen lässt, zieht den Leser lautstark in die Kanäle der Stadt, in die Paläste, deren Mauern niemals schweigen werden und in die feine Gesellschaft der Renaissance. Und hier stinkt es mancherorts gewaltig.