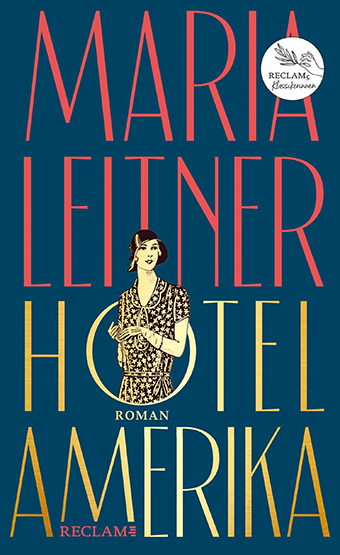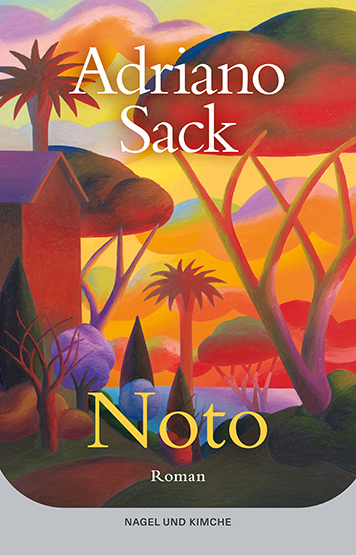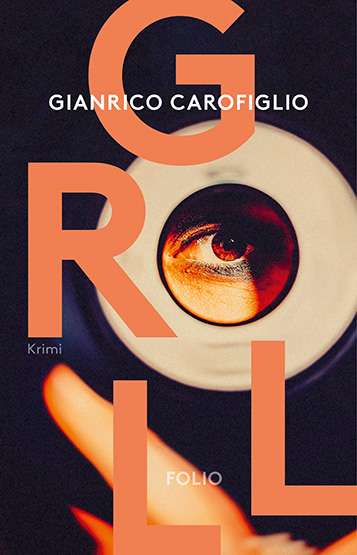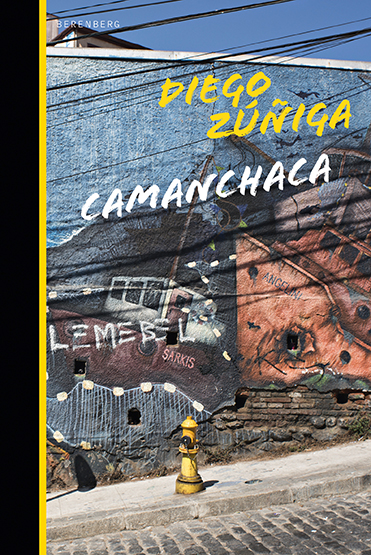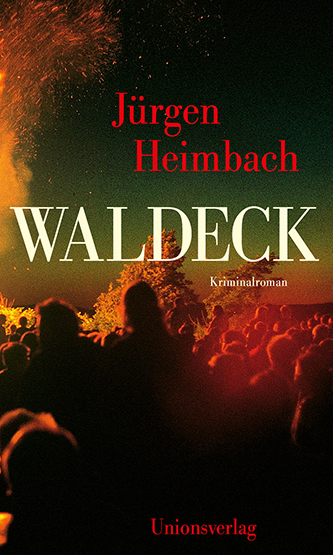Eine Hochzeit ist ein festlicher Anlass, ein freudiges Ereignis, in den meisten Fällen eine einmalige Sache. Für die direkt Beteiligten auf jeden Fall. Für alle drumherum, die die daran arbeiten, die Angehörigen etc. oftmals eine stressige Angelegenheit. Für Shirley, Ingrid und Franz ist es der ganz normale Wahnsinn im Hotel Amerika. Sie sind nach Amerika gekommen, um das große Glück zu finden. So ein Glück wie Braut und Bräutigam wollen sie auch haben … anfangs.
Shirley, aus Irland eingewandert, posaunt vielsagend in die Welt hinaus, dass sie es ihr letzter Tag sei im Hotel Amerika. Dann käme sie als Gast wieder. Ingrid, Schwedin, ein junges Ding, die immer noch Schwierigkeiten mit der Sprache hat, findet in Shirley eine gute Freundin. Sie sind guter Dinge, dass ihr amerikanischer Traum in Erfüllung gehen kann. Und dann ist da noch Fritz. Aus Berlin. Am frühen Morgen kreuzt er die Finger, dass es endlich klappt mit einer Festanstellung im Hotel Amerika. Sie alle haben keine Flausen im Kopf – Shirley vielleicht ein bisschen. Ihr Job ist ein harter Job. Ihre Träume sind greifbar und doch so fern. Und mit dem heutigen Tag sollen diese Träume ein Stück weit Realität werden.
Doch es kommt anders. Die Braut wird mit einer Nachricht konfrontiert, die ihr ganzes Leben auf den Kopf stellt. Die Hochzeit steht auf der Kippe. Und im Hotel geht es drunter und drüber. Es ist nur ein Tag, der das ganze Leben aller verändern wird. Und diesen Tag beschreibt Maria Leitner auf wunderbare Weise.
Die Autorin selbst hatte ein bewegtes Leben. Sie genoss als eine der Wenigen eine fundierte Ausbildung. Sprach mehrere Sprachen. Reiste um die Welt. Doch die gesellschaftlichen Veränderungen im Deutschland des 20. Jahrhunderts – Krieg, Weimarer Republik, das Terrorsystem der Nazis – machten ihren Plänen fette Striche durch die Rechnung. Sie floh, kehrte aber ebenso oft, mit falschen Papieren ins brauen Deutschland zurück, um über das Voranschreiten des menschenverachtenden Systems berichten zu können. Doch ihre Flucht endete in einem Desaster. Ihre Bücher brannten als erste auf den Scheiterhaufen der unerwünschten Schriften. Sie hungerte, wandte sich an helfende Hände, wurden von den Nazischergen gefasst und starb einsam und vergessen in deren Gewahrsam. Erst Jahrzehnte nach ihrem Tod konnte dieser einwandfrei festgestellt werden. Die hilfreichen Hände, die Größen wie Feuchtwanger, Brecht und Mann den Weg in die Freiheit ebneten, waren für Maria Leitner nicht greifbar. Ihr Name geriet in Vergessenheit. Ihr erster Roman „Hotel Amerika“ ist nun endlich wieder verfügbar. Ein Juwel, dass eindrucksvoll beschreibt, wozu Menschen fähig sein können, wenn die Umstände die Wahl der Mittel bestimmen.