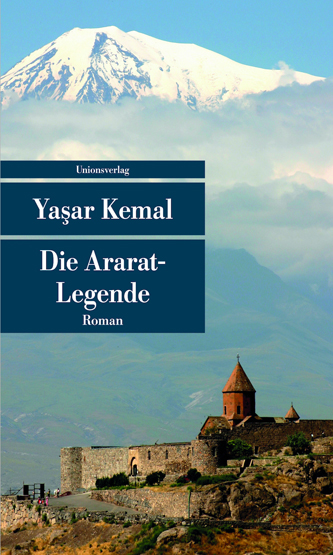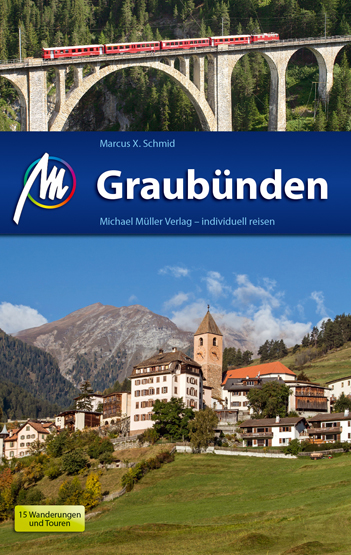Partisanen allein bringen keine Ordnung zu Fall. Sie sticheln, tun ihr weh, knabbern an den Werten, doch endgültig fällen, dafür sind sie zu schwach. Doch ohne die Querdenker wäre die Ordnung arbeitslos, könnte schalten und walten wie sie will. Langeweile und Diktatur wären die Folgen.
„pARTisan“ heißt eine Zeitschrift, eine Bewegung in Belarus. Herausgeber ist Artur Klinaŭ. Und in diesem Buch sind kurze Texte zum Thema Partisanen und ihrem Kampf nun veröffentlicht worden. Verschiedene Autoren berichten aus der Welt, aus ihrer Welt vom Kampf der Künstler im Partisanengewand gegen die Obrichkeiten.
Im Jahr 2016 lesen sich manche Geschichten wie ein Witz. So was gibt’s noch, fragt man sich kopfschüttelnd. Weißrussland, einst eine blühende Sowjetrepublik, die die besten Chancen hatte, aus der Aufspaltung der UdSSR als großer Gewinner hervorzugehen, ist heute das Land in Europa mit der geringsten Freiheit. Unabhängige Medien sind dazu verdammt im Untergrund zu agieren. Rede- und Meinungsfreiheit werden im Keim erstickt. Wirtschaftlich wird es von einer dem Diktator Lukaschenka hörigen Clique halbwegs am Leben erhalten, die sich selbst die Taschen vollstopfen.
Die Texte beweisen eindrücklich, dass Kampf nicht immer als Blutvergießen im wortwörtlichen Sinne zu verstehen ist. Die Feder ist oft schärfer als das Schwert. Jede Zeile strotzt vor Kampfeswille und ist erfüllt von Siegermentalität. Keine hohlen Phrasen, irrationalen Durchhalteparolen, sondern Augen öffnende Argumentationen, denen sich nur die verschließen, die (noch) das Sagen haben.
„Partisanen“ gibt einen Einblick in das Leben von unterdrückten Künstlern, die sich ihrer Stimme bewusst sind und sie auch einzusetzen wissen. Für den Leser ist dieses Buch eine völlig neue, fremde Welt. Nur ab und zu gelingt es Journalisten aus dem verschlossenen Belarus / Weißrussland zu berichten. Immer mit der Angst im Nacken entdeckt zu werden oder hören zu müssen, dass eine oder mehrere Quellen inhaftiert wurden. Die Nadelstiche, die die Künstler setzen, stammen von ihrer spitzen Federn und die Narben werden noch lange nicht verheilen.