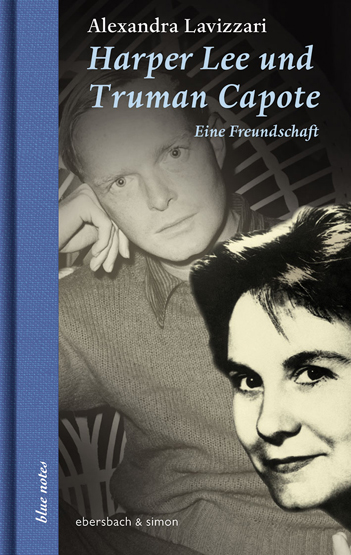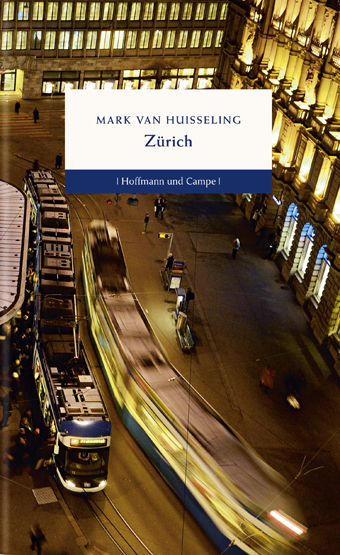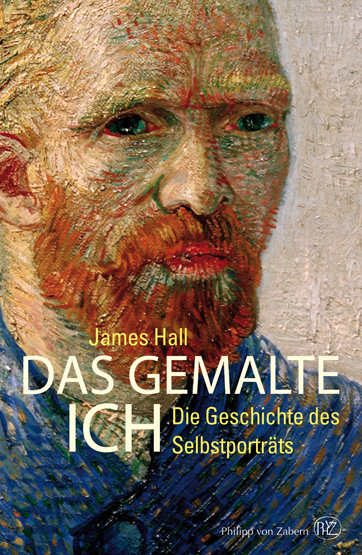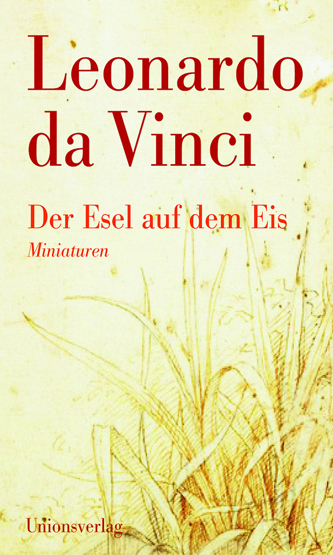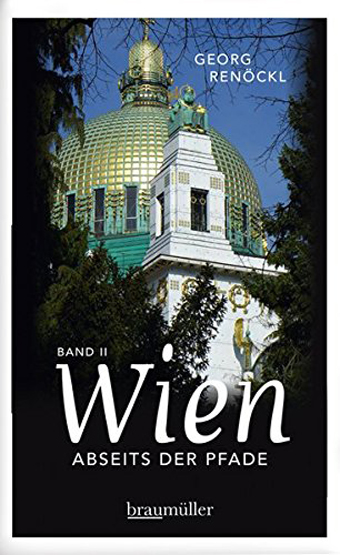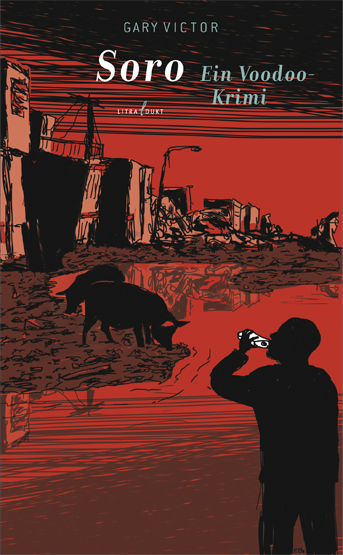Quadratisch, praktisch, gut – nicht nur irgendein Werbespruch, der zwar nicht auf Paris zutrifft, jedoch auf die Art-12-Collection. Und auf diesen Paris-Kalender im Besonderen. Es gibt so viele Attribute, die auf Paris zutreffen, so viele Beinamen, die die Stadt schon erhalten hat, fehlt eigentlich nur noch einer: Kalender-Hauptstadt der Welt. Kaum eine andere Stadt wird so oft auf Kalendern verewigt wie Paris. Es bietet sich aber auch an. Dieses Modell zeigt die gesamte Spannweite der Motive: Vom Riesenrad am Place de la Concorde, über Sacre-Cœur bis hin zu Eiffelturm und Notre-Dame. Das Besondere des Kalenders liegt nicht an der Motivauswahl, es sind die Einstellungen, die Blickwinkel und die detaillierte Wiedergabe der Orte, die man unbedingt sehen muss, die man gesehen hat und die man immer wieder besuchen will. Schon beim Titelbild rätselt man von wo aus dieses Bild gemacht wurde. Ein Wohnhaus – mehrere Etagen – das unter dem Eiffelturmbogen zu verschwinden scheint. Es ist natürlich eine Fotomontage. Aber so gut gemacht, dass man es als gegeben hinnehmen kann.
Real ist der Blick von Notre Dame an einem Wasserspeier vorbei über die Seine bis hin zum Eiffelturm. Und zwar so scharf, dass man fast die Marke der Schuhe der Parkbankbenutzer sehen kann. Die wahre Kunst der Fotografie besteht im Handwerk. Einen Wasserspeier kann jeder fotografieren. Aber kleine Risse, feinste Ziselierungen, Kanten und Konturen, dazu noch in schwarz-weiß, das kann nicht jeder.
Ach ja, ein paar Kalendertage sind auch noch abgedruckt. Die werden fast übersehen bei so viel Detailreichtum der Bilder. Jetzt braucht man nur noch einen Stift, zieht einen Strich quer über die Kalendertage und schreibt ganz groß darüber P-A-R-I-S!