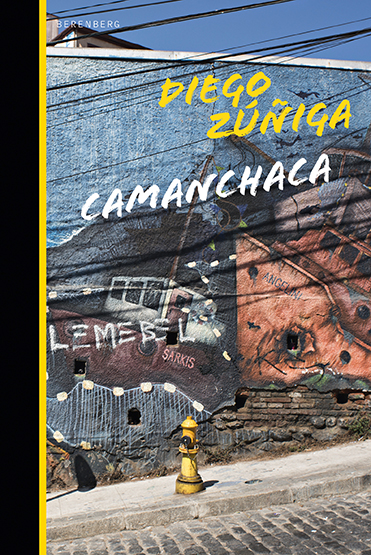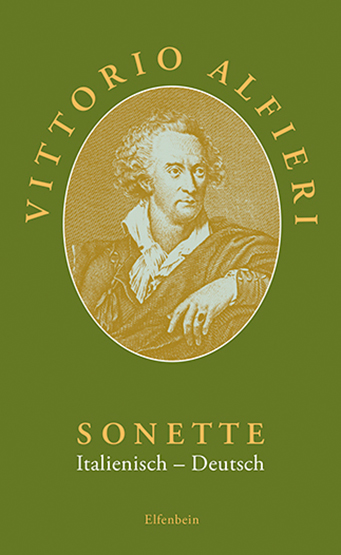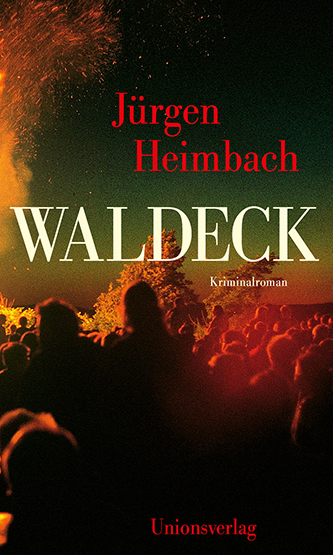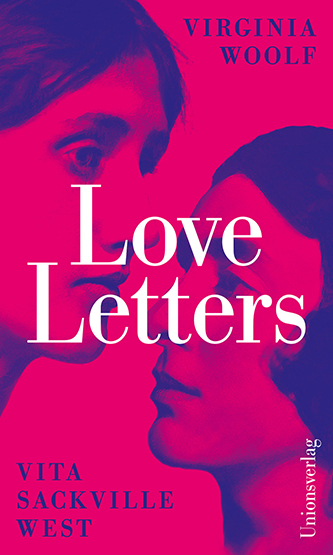Die Wüste ist öde. Für einen jungen Mann, dessen Zähne ihn viel älter erscheinen lassen, dessen Gewicht zum Spott von Anderen einlädt, dessen Familie zerbrochen ist, ist die Wüste der ganz normale Alltag. Sein Leben ist öde. Er wäre gern Sportreporter geworden. Fußball. Im Stadion sein, mit Leidenschaft das Goooooooooooooooooooooooooool verkünden.
Doch das Leben war in seinem kurzen Leben schon verdammt hart zu ihm. Die Eltern getrennt, weil Papa eine Neue hat. Mama und ihre chronischen Geldsorgen. Die Einsamkeit.
Nun sitzt er im Auto zusammen mit Papa, Nancy, seiner neuen Frau und seinem Halbbruder, der die ganze zeit nur am Gameboy zockt. Gen Peru geht es. Zum Einkaufen und zum Zahnarzt. Er lässt alles über sich ergehen. Nur die Musik auf seinem mp3-Palyer lässt ihn ein wenig träumen. Er erinnert sich an die Besucher bei Opa und Oma. An die Träume. An das Champions-League-Finale 1999, Manchester United gegen die Bayern. Wie oft hat er – nicht nur in Gedanken – dieses denkwürdige Spiel als Reporter vom Sofa aus noch einmal angeschaut und kommentiert. Der sicher geglaubte Siege der Bayern, der in der Nachspielzeit so effizient wie brutal zermalmt wurde. Fast so wie sein Leben…
Diego Zúñiga lässt die wahren Hintergründe all dessen im Nebel des Vergessens verschwinden. Niemand hat einen Namen, außer Onkel Neno. Der ist tot. Überfahren. Vom Vater des Jungen, der so still und teilnahmslos die Wüste durchquert. Er darf die Einkaufsliste, die ihn seine Mutter gegeben hat nicht vergessen. Doch dabei will er so gern alles Mögliche vergessen. Oder Antworten bekommen. Ein anderes Leben führen.
Für Touristen ist die Reise von Chile nach Peru unter Garantie ein Abenteuer, das sie nie vergessen werden. Für den Jungen ist es lästige Pflichterfüllung. Er braucht keine Zeit, um sich zu erinnern. Die Gedanken um den Tod des Onkels, die Trennung der Eltern sind allzeit präsent. Es wird kein happy end geben. Wie sollte das auch aussehen?