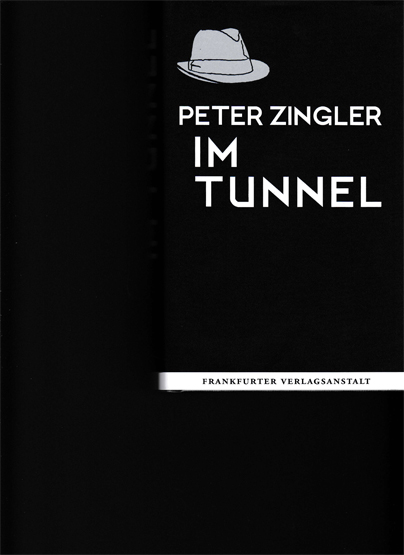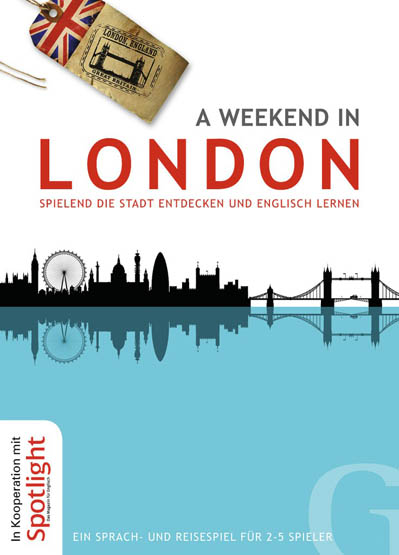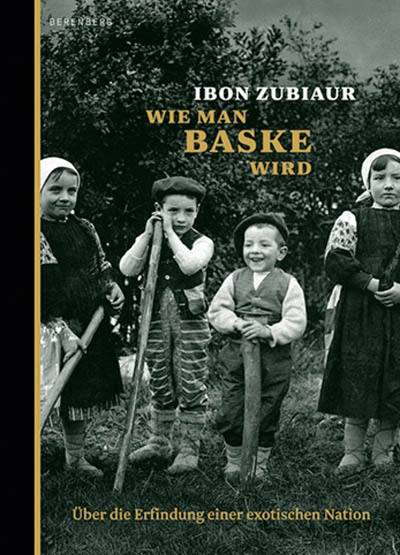Papa Shango lacht furchteinflößend in die erschrockenen Gesichter. Gevatter Tod schwenkt vergnügt seine Sense. Eine Brass-Band spielt fröhlich in den Straßen New Orleans‘ zum letzten Geleit. Der Tod kann auch fröhlich sein. Doch niemals so fröhlich wie in diesem Buch.
Kathy Benjamin hat Geschichten gesammelt, die einem die (Freuden-) Tränen in die Augen treiben.
Viele Rituale rund um die Toten haben sich bei den (noch) Lebenden eingeprägt. Die Ursprünge sind selten nachvollziehbar bzw. werden nicht hinterfragt. Zum Beispiel warum Tote mit dem Kopf nach Westen begrabe werden. Oder warum Tote mit den Füßen voraus getragen werden (damit man sie nicht am Kopf stößt?, mutmaßt die Autorin lakonisch).
Die Geschichten und Histörchen werden allesamt nicht so todernst genommen. Es ist ein heiteres Buch, das mit Bonmots von (teils bereits verstorbenen Komikern und Schriftstellern) gewürzt wird. Die kurzen Kapitel erlauben es, dass das Buch in vielen kleinen Abschnitten gelesen werden kann, was es zu einem dauerhaften Lesebuch macht.
Der Tod ist erstinstanzlich eine traurige Sache. Der Tote kommt nicht wieder zurück. Er wird nie wieder jemanden auf den Schoß nehmen, singen, lachen oder die Welt erklären. Man kann dem Tod auf verschiedene Art und Weise begegnen: Heulend, fluchend, verzweifelt. Aber auch mit einem Lächeln im Gesicht. Der Fratze die Stirn bieten. Die schöne Tradition des Leichenschmauses gehört zu Letzterem. Anregungen wie man ein letztes Mal des Verstorbenen gedenkt, bietet dieses Buch allemal.
Fest steht: Die letzte Reise, die man unternimmt, wird nicht mit dem Kapitel „Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen.“ Und damit die Hinterbliebenen doch was erfahren, hat Kathy Benjamin mit diesem Buch schon mal vorgesorgt. Ein kurzweiliger Trip ins Reich der Toten.