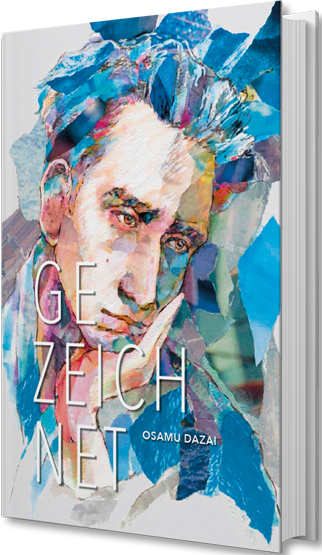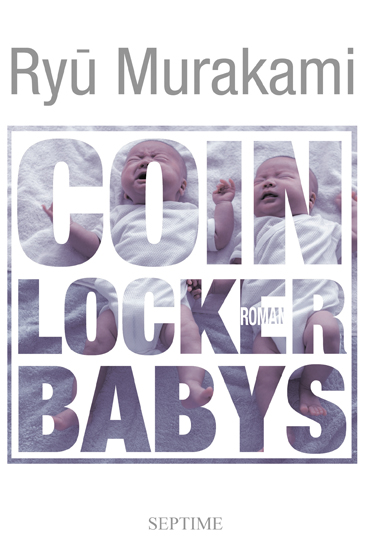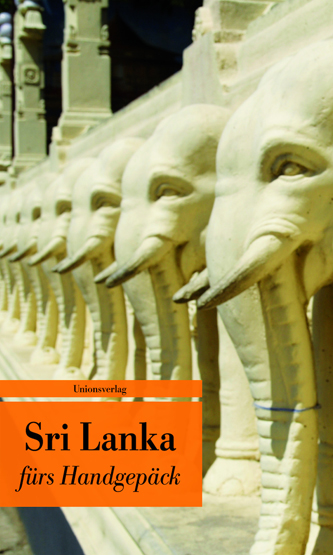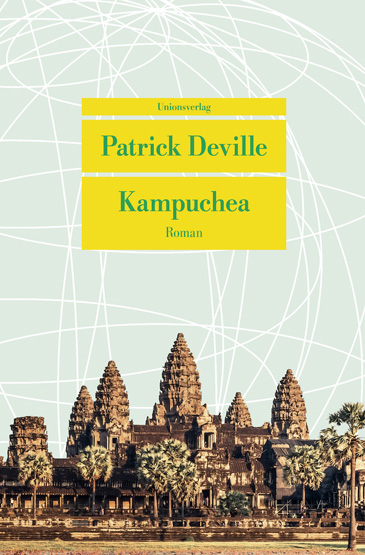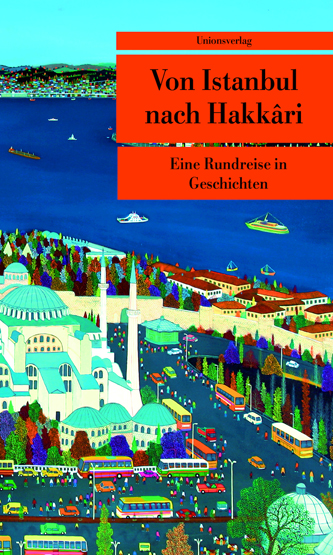Sich verbiegen, um den geraden Weg einschlagen zu können. Su Nuam ist fünfzehn Jahre alt. Und sie arbeitet schon. Als Übersetzerin. Aufgewachsen ist sie in der Nähe von Buenos Aires. Ihr Vater, ein Chinese, wird eines Tages von einem wütenden Mob ermordet. Sie und der Rest der Familie flieht. Nach China, zu den Großeltern.
Auf einmal ist nichts mehr wie es war. Keine nörgelnde Spanischlehrerin, die ihr Vorhaltungen macht, weil sie die Zeitformen nicht einhält – hier ist wichtig zu wissen, dass es im Chinesischen keine Verbformen dafür gibt. Die Freunde sind von einem Tag auf den anderen nicht mehr greifbar. Der Platz, der so trostlos ihr Refugium war, weicht dem hektischen Treiben in der Fremde.
Da kommt das Jobangebot als Übersetzerin für ein Unternehmen zu arbeiten gerade richtig. Und sie ist gut in dem, was sie tut. So gut, dass sie auch auf Reisen mitgenommen wird. Und eine führt sie geradewegs in ihre jüngere Vergangenheit zurück. Der Großvater als Begleiter ist ihr dabei die Stütze, die sie braucht, um nicht von ihrem geraden Weg abzukommen.
Federico Jeanmaire gelingt mit „Richtig hohe Absätze“ das Kunststück Gerechtigkeit in seiner reinsten Form in glaubwürdige politische Unkorrektheit überfließen zu lassen. Natürlich ist das junge Mädchen traumatisiert. Sie musste mit ansehen, wie teilweise sogar Freunde, ihrem Vater das Lebenslicht auslöschen. In Argentinien war sie sich nicht sicher, ob sie Chinesin oder Argentinierin ist. Zurück in China fühlt sie sich als Argentinierin mit chinesischen Wurzeln. Je näher sie dem Flughafen Buenos Aires kommt, desto mehr treten ihre chinesischen Wurzeln wieder hervor. In ihrem Kopf summt es, es klirrt, es scheppert.
Die Reise wird für die Unternehmensdelegation zum Erfolg. Der Deal zum Bau einer Gasleitung kann abgeschlossen werden. Auch dank Su Nuams Mithilfe, die gnadenlos jede Äußerung übersetzt. Ein Handgeld soll ihre Extrabelohnung sein. Und was wird sie sich wohl davon kaufen? Richtig: Schuhe. Aber welche mit richtig hohen Absätzen…
Eine Kurzgeschichte, die den Leser einfach nur amüsiert und von der ersten Seite an in ihren Bann zieht? Ja, und vor allem ein ganz großes Nein. Denn der Reiz der Geschichte liegt zwischen den Zeilen. Su Nuam reist nicht einfach nur zurück nach Argentinien. Sie reist zurück mit ihrem Spanischheft. Das birgt für alle außer ihr ein Geheimnis in sich, das den Leser erst nach und nach auffällt…