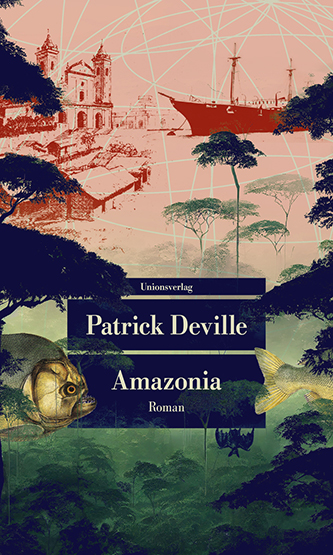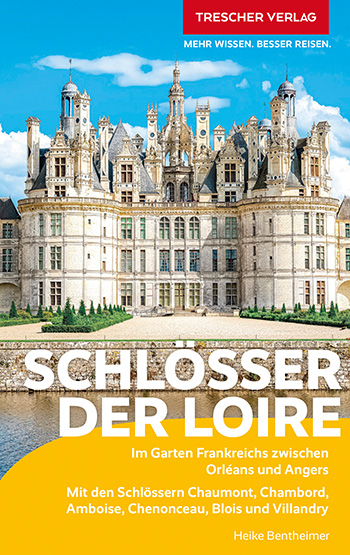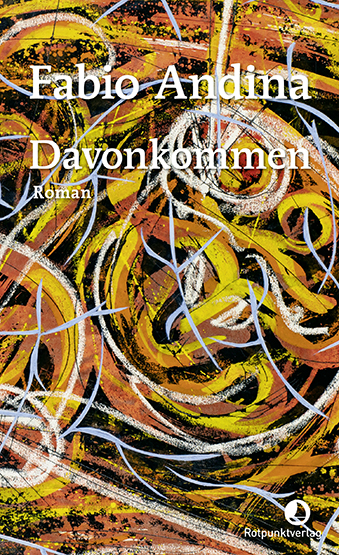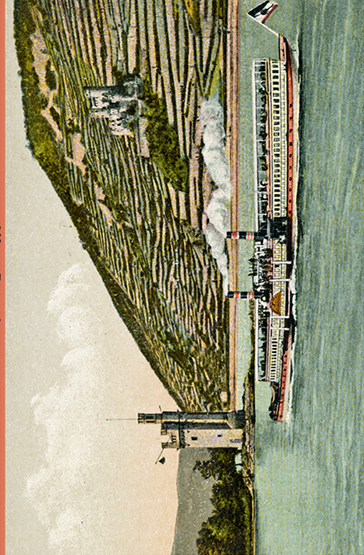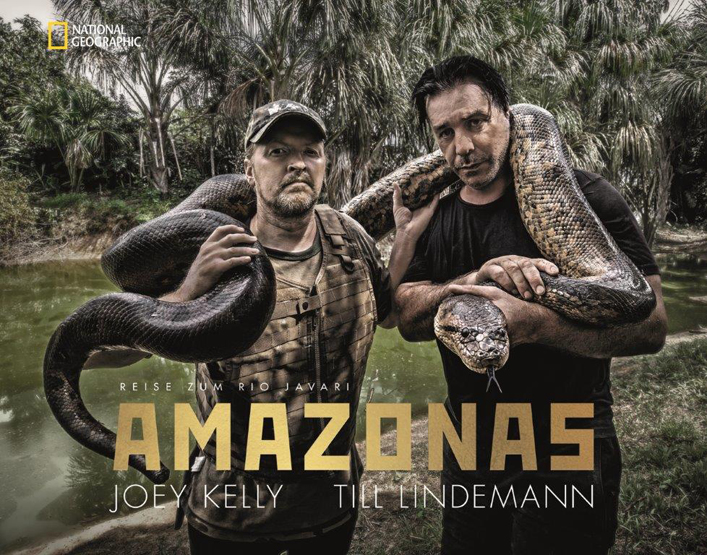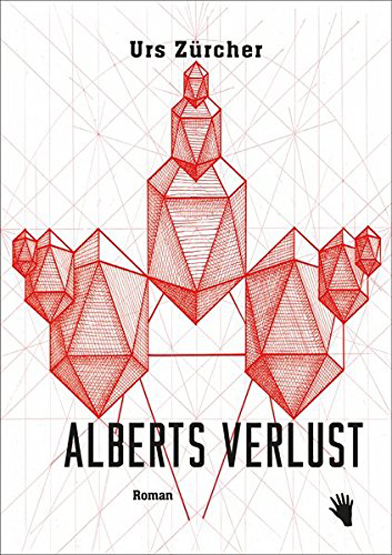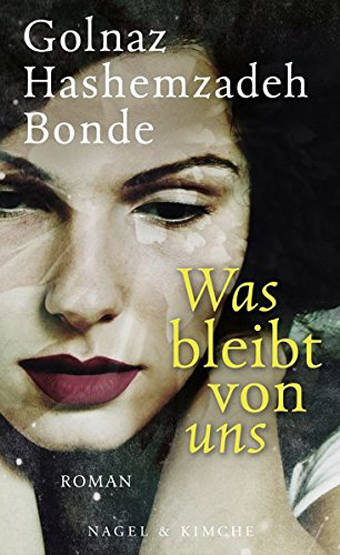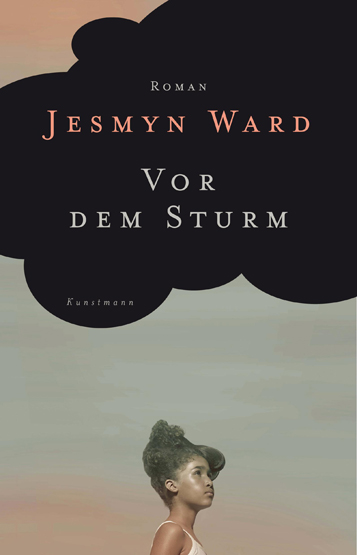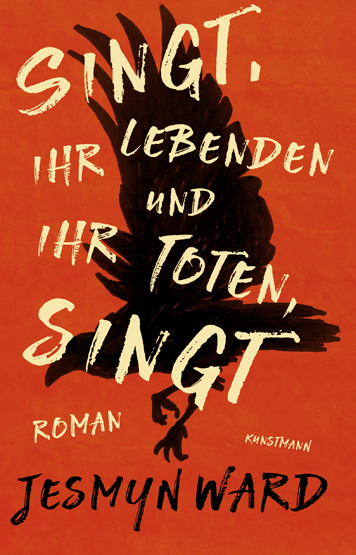Was haben Alexander von Humboldt, Jules Verne und Klaus Kinski gemeinsam? Ihr Ruhm ist eng mit dem Amazonas verbunden. Der Eine durchstreifte den Dschungel, mit diesen Erkenntnissen konnte der Zweite einen faszinierenden Roman schreiben und der Dritte fühlt e sich hier wie der König der Welt, vor und neben der Kamera. Der Amazonas zieht alle in seinen Bann. Und so war es nur eine Frage der Zeit bis (endlich!) Patrick Deville auch dem Amazonas-Fieber verfiel.
Einmal mehr nimmt er den Leser mit ins Dickicht der Unwissenheit, um mit der Machete der Neugier und dem Drang nach Abenteuern das Licht der Erkenntnis zu finden. Es wird eine Entdeckungsreise der persönlichen Art. Denn viele der Pflanzen und Tiere, die – meist nur hier – vorkommen, wurden schon einmal entdeckt. Aber eben noch nicht von Patrick Deville.
Vielmehr liegen ihm aber die Begegnungen am Wegesrand am Herzen. So versinkt er in der Geschichte der Stadt Manaus mitten im Herzen Brasiliens, dort, wo der Amazonas in schier unendlicher Breite Siedler dazu brachte sich niederzulassen. Heute eine schwitzige Metropole, die in Sachen Quirligkeit den Hafenstädten am Atlantik und am Pazifik in Nichts nachsteht. Und das obwohl sie tausende Kilometer von jedwedem Meer entfernt ist. Hier steht das dschungeligste Theater der Welt, hier herrscht eine Lebendigkeit, die weder durch extreme Luftfeuchtigkeit noch exorbitante Kriminalität beeinflusst wird.
Immer wieder kommt Patrick Deville mit Menschen zusammen, die das Schicksal hier her verschlagen hat. Botschafter, Glücksritter, Einheimische, die ihre Nachbarschaft noch nie verlassen haben. Sie alle zeichnen dem Autor und somit auch dem Leser ein Bild einer Landschaft, das so farbenfroh ist, dass man geblendet ist von der Pracht der Eindrücke. Von Hernán Cortés über die ersten Siedler bis zu Werner Herzog, der wie kein anderer (Verrückter) dem Dschungel und dem Fluss ein Denkmal setzte, stapft Patrick Deville durch die Geschichte dieser Region, um Behutsam ihre Geschichten aufzudecken. Schon nach wenigen Seiten ist man ein Fan. Fan von dieser einzigartigen Landschaft, die dem Verfall preisgegeben wird. Fan von Patrick Deville – sofern man es nicht schon lange ist, schließlich führen seine Bücher Leser seit Jahren durch das Kambodscha der Roten Khmer, das Mexiko Leo Trotzkis, das Afrika bedeutsamer Forscher und und und – weil er es versteht Verständnis zu zeigen und zu vermitteln. So eine Forschungsreise macht man am Liebsten mit Patrick Deville!