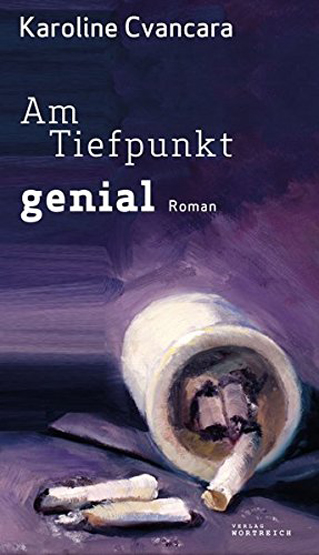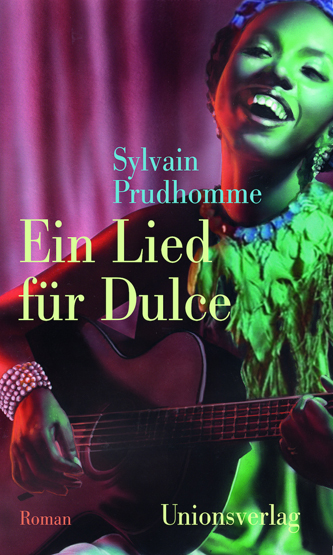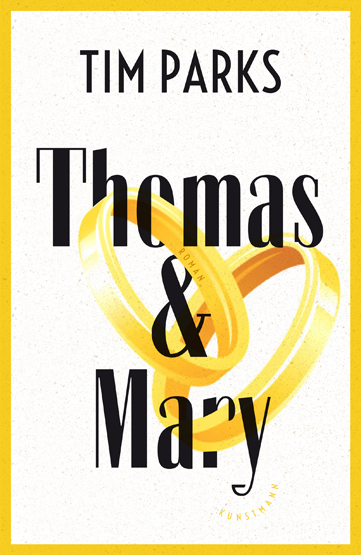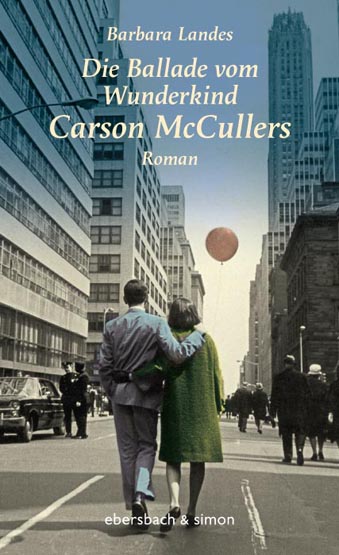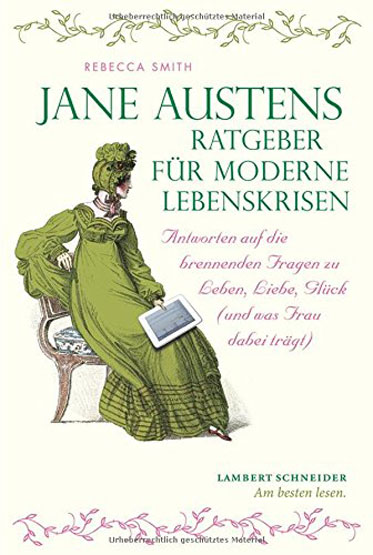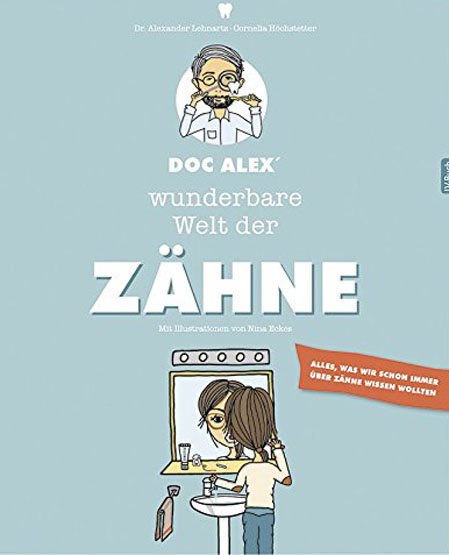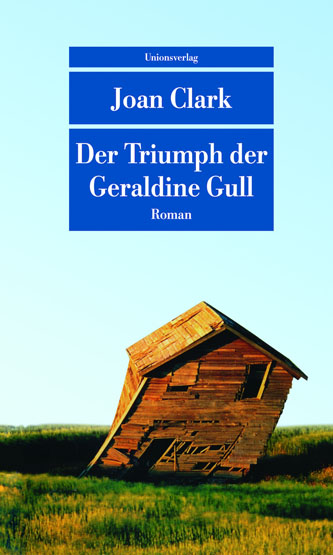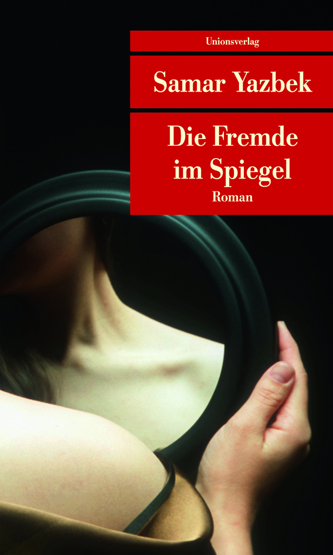Hannahs Leben war bis eben ein Desaster. Da kam der Auslandsjob – sie ist Schauspielerin – wie gerufen. Einfach bloß weg, sich ablenken, sich mit anderen Dingen beschäftigen … eine neue Liebe. Doch auch das ist nun vorbei. Sie liest in ihrem Tagebuch, das sie eigentlich gar nicht schreiben wollte. Und sie liest, obwohl ihr alles noch so präsent ist, dass auch die neue Liebe passé ist. Tot, der Geliebte, die Klappe auf der Bühne war schuld. Peng!, sie fiel zu – der Geliebte im Jenseits. Nicht nur auf der Bühne. Ihre Schuld? Ihre Schuld! Hannah findet keine andere Lösung, so sehr sie auch sucht. Sie ist schuld am Tod ihres Geliebten.
Doch das Leben hat die Angewohnheit fortzuschreiten. Beim Casting für ein neues Projekt fällt sie auf. Lviv, Lwow, Lemberg ist der temporäre Lebensmittelpunkt. Und auch hier in der Fremde gibt es Vertrautes. Vertraut die Fremdheit des Hotelzimmers. Alles so clean, so stringent, alles an seinem Platz, aber ohne Liebe, ohne persönliche Note. Fremd ist die Stadt, fremd das Gefühl wie ein Star behandelt zu werden. Hannah bemerkt beide Seiten der Medaille, doch ist wenig beeindruckt.
Sie schlendert durch den Park und trifft ihr Schicksal in Person von Aaron, dem Saxofonspieler. Seine wachen Augen, seine behändes Spiel, seine Fähigkeit im richtigen Moment das richtige Zitat zu bringen, verblüfft sie.
So lebensbejahend Aaron auch ist, so betrübt ist sein Herz. Und Hannah versteht ihn besser als je ein Mensch zuvor. Wenn das Wort Seelenverwandtschaft je zutraf, dann auf Aaron und Hannah…
Sibylle Schleicher schickt den Leser auf eine Reise durch das unbekannte Lviv/Lemberg. Das Schicksal der beiden endet in einem Labyrinth der Gefühle, aus dem sie nur schwer wieder herauskommen. Gewolltes Exil oder Schicksalsergebenheit? Jedes Umblättern ist Nervenkitzel par excellence. Wie in einem düsteren Krimi noir schreitet man mit den Hannah und Aaron auf den Abgrund zu, der unausweichlich scheinen mag. Die Suche nach dem Grabe des Vaters und die Suche nach Befreiung führen auf ein und denselben Weg.
Zwischendrin, kaum merklich, verwandelt sich der Roman in einen Reiseführer. Das einstige Lemberg erwacht in den Worten von Sibylle Schleicher zum Leben. Die Spaziergänge, die Hannah unternimmt, sind kleine Ausflüge durch eine Stadt, die ihrer Blüte hinterherhinkt und der Pracht nachweint. Doch die Spuren der Vergangenheit sind weder bei Hannah noch bei Aaron noch bei der Stadt komplett verschwunden. Wer ein wenig an ihnen kratz, wird belohnt werden.