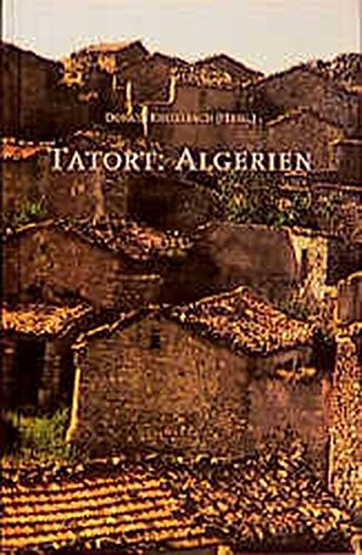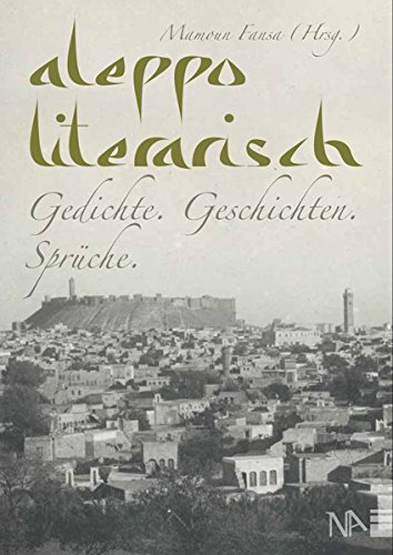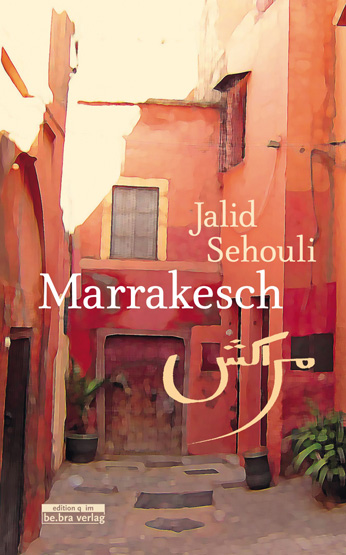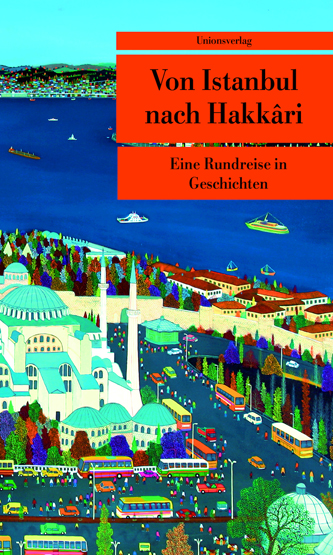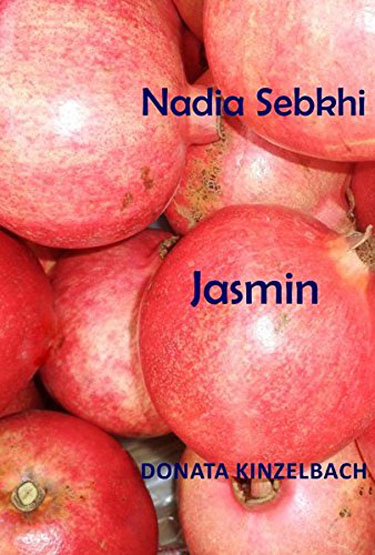Das Rad zurückdrehen, um das Heute verstehen zu können. So geht es einem, wenn man dieses Buch liest. „Tatort: Algerien“ – ein martialischer Titel. Doch es ist nicht der Titel, der martialisch ist, sondern die Fakten in ihm.
1998 war vom so genannten arabischen Frühling noch keine Rede. Algerien stöhnte unter der Knute des Terrors. Ein unsicheres Land. Für Touristen fast unbereisbar. Ein starres System, das seine Macht mit allen Mitteln verteidigte. Freie Wahlen gab es maximal auf dem Papier. Abgebrochene Wahlen waren die Realität. Fundamentalistische Gruppen marodierten durchs Land und verbreiteten Angst und Schrecken. Die Intelligenz des Landes floh, wie so viele.
Wer es sich dennoch erlaubte Zeilen niederzuschreiben und gar zu veröffentlichen – egal, ob er im Ausland war oder die Heimat nicht verlassen konnte – dem drohte im Mindesten Ungemach, im Normalfall Repressionen, zu oft der Tod.
Jeder der Autoren, die Texte zu diesem Buch beisteuerten, konnte sich sicher sein seinen Namen in einer Art Hitliste des Grauens wiederzufinden. Todeslisten. Doch sie ließen sich nicht unterkriegen. Sie berichten von grausamer Folter. Ein Arzt, ein Intellektueller wurde direkt vom Krankenbett eines Kindes verschleppt. Zuerst nahm man ihm die Finger, dann weitere Gliedmaßen bis hin zur Verstümmelung. Sein Todeskampf dauerte einen Tag.
Es sind nicht die im Buch beschriebenen brutalen Methoden, die das Buch zu einem besonderen Buch machen. Es sind die Ohnmacht und der nicht enden wollende Wille zum Kampf und zu Veränderung des Landes und der Kämpfer, die mutig ihren Kopf und ihre Stimme erheben.
Wer Parallelen zur Gegenwart (nicht zwingend verortet im maghrebinischen Raum) erkennt, ist nicht verwirrt, sondern ein aufmerksamer Beobachter der Aktualität. Zwanzig Jahre existiert dieses Buch. Lehren wurden kaum geschlossen. Die alten Köpfe sind weg – neue Köpfe haben das sagen. Die Perfidität der Machterhaltung hat lediglich eine andere Form angenommen.