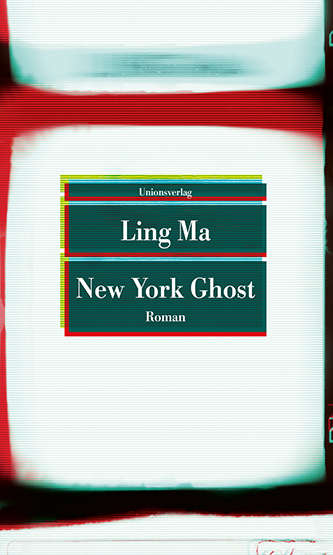Da arbeitet man Tag für Tag. Gibt alles für die Firma. Soziale Kontakte – Fehlanzeige. Und dann sagt einem niemand, dass da draußen die Welt untergeht?! So sehr man darüber schmunzeln möchte, so bitter ist die Wahrheit für Candace Chen. Während sie den Kopf in ihre Arbeit hängt, grassieren in New York lebensgefährliche Pilzsporen. Immer mehr Menschen flüchten aus der Stadt. Die Straßen werden immer leerer. Bis … ja, bis schlussendlich nur noch Eine übrig ist. Eine in der Stadt die losen Fäden ihres Daseins und die der Firma in den arbeitsamen Händen hält. Candace hat die Apokalypse schlichtweg … verarbeitet. Verarbeitet im Sinne von durch Arbeit verschlafen.
Die Renaissance der Yuppies geht einher mit der zweiten Entstehung der Hipster, die mit den eigentlichen Hipstern so gar nichts gemein haben – Stil ist zeitlos, affektiert. Immer mehr Menschen müssen sich spezialisieren, um im Beruf Schritt halten zu können. Das wirft allerdings das Problem auf, dass man nichts mehr links und rechts des Wegs etwas wahrnimmt. Das machen ja schließlich „die Anderen“. Die Anderen sind immer eine Gemeinschaft. Man selbst ist Spezialist und qua Definition Einzelgänger, in der Krise Einzelkämpfer. Candace wird das schon noch merken. Spät, als die Pilzsporen New York übersät haben und ein ungeheures Fieber verursacht haben. Nun muss sie sehen wie sie Anschluss findet, um einen Schlussstrich unter ihr bisheriges Leben ziehen zu können.
Wie war das vor einigen Jahren als Corona jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde unseres Lebens bestimmte? Maskenpflicht, Einschränkungen bei jedem Schritt in der Öffentlichkeit, Kontaktverbote. Kaum ein Roman der jüngeren Vergangenheit ist uns so nah wie „New York Ghost“. Die Spötter und Zweifler auf den Barrikaden finden in diesem Roman sicher nicht die ersehnte Befriedigung. Doch die „Kritik am System“ ist durchaus erkennbar. Da ist eine junge Frau, die das Pflichtgefühl über ihre Entwicklungsmöglichkeiten als Mensch stellt. Nur nicht den Chef verärgern, nicht anecken, immer brav arbeiten. Und kostet es die letzte freie Minute. Und wofür? Für Nichtbeachtung in einer Gesellschaft, die sich digital immer mehr vereint, ohne dabei zu merken, dass Vereinigung virtuell nur partiell stattfinden kann.
Ling Ma zeichnet ein düsteres Bild unserer Zeit. Dennoch geht das Leben weiter. Leben vergehen, Leben entsteht. Die Kritik, dass immer erst etwas passieren muss, damit sich grundlegend etwas ändert, ist auf jeder Seite spürbar. Veränderung ist nicht immer planbar. Manchmal ist es sogar kontraproduktiv – um im Sprachgebrauch der „Vor-Pilzsporen-Zeit“ zu bleiben – eine umwälzende Veränderung zu planen. Man kann halt nicht alles voraussehen. Und das ist es doch, was das Leben so spannend macht.