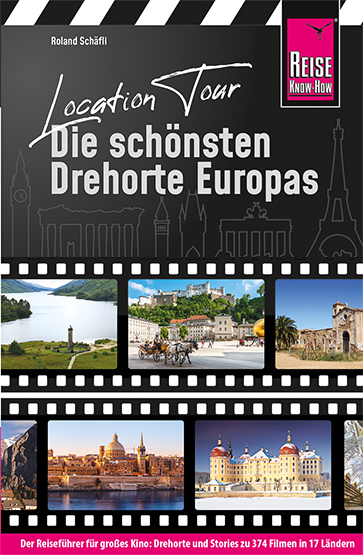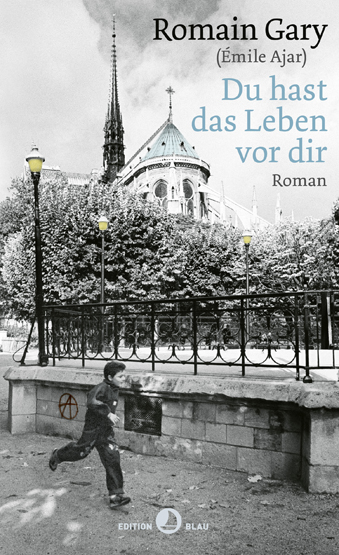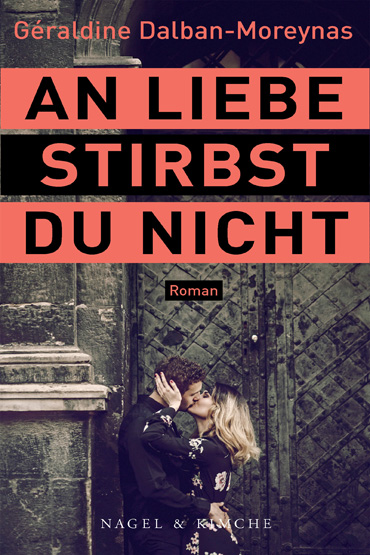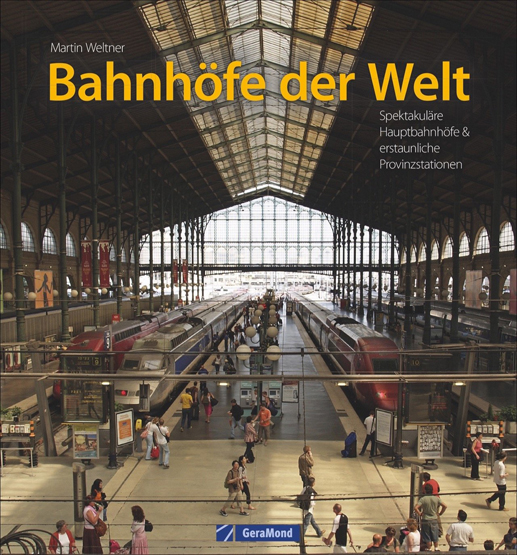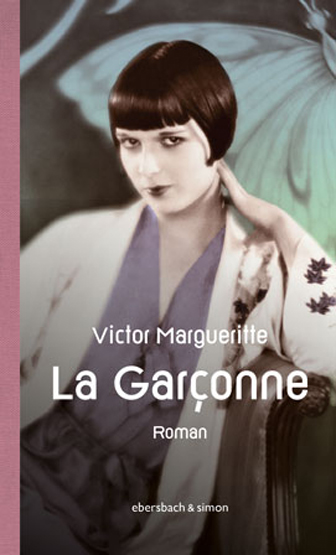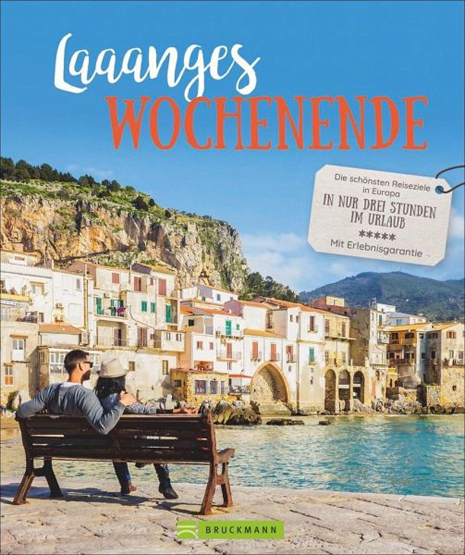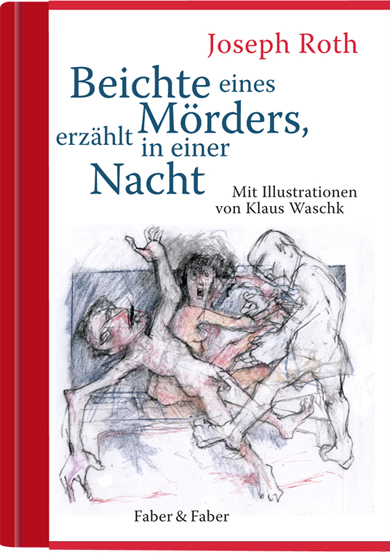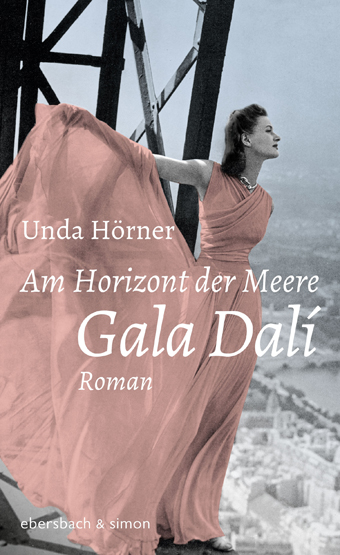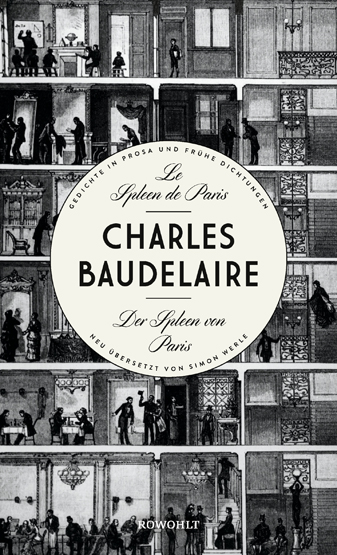Noch einen Kaffee, und einen Whiskey … bitte! So geht das schon seit Längerem. Durch Paris streifen – nach dem Plan von Estelle. Flugblätter verteilen – nach Estelles Plan. Auf den Flugblättern ist das Gesicht von Jennifer abgebildet. Seiner Tochter. Jons Tochter. Jons und Estelles Tochter. Seit einer gefühlten Ewigkeit ist die Kleine verschwunden.
Jede Metrostation wird zu der Zeit besucht, zu der die meisten Menschen dort sind. So erhöht sich die Trefferquote, theoretisch. Zuhause hält Estelle Telefonwache. Falls Marceau, der ermittelnde Beamte, falls irgendjemand anruft, der Jennifer gesehen hat.
Noch einen Kaffee, und einen Whiskey … und wissen Sie wer dieses Plakat da gemalt hat? Jon ist gebannt vom Detailreichtum des Bildes. Alles an diesem Bild scheint nur einem Ziel zu dienen: Die abgebildete Person in ihrer ganzen Vielfalt darzustellen. Ohne, dass es ihm bewusst ist, fühlt er, dass er die Künstlerin kennenlernen muss. Vielleicht kann sie ihm helfen.
Das Plakat, das sie zeichnet, scheint Erfolg zu versprechen. Die neuen Flyer zeigen eine Jennifer, die so unverwechselbar ist, dass man sie auf Anhieb erkennt. Die Saat für eine gelungene Ernte ist in den Boden gebracht.
Und dennoch sprießen aus dem Boden nur welke, zarte Pflänzchen. Denn alles hat sich von Grund auf geändert. Estelle ist es leid. Sie kann immer noch nicht in Jennifers Zimmer gehen, aus dem nach und nach ihr Geruch verschwindet. Jon hat sich verändert. Das Zusammentreffen mit der Künstlerin hat weiter reichende Folgen als man planen kann. Die Melancholie ist weg. Selbst Marceau ist mit einem Mal zuversichtlich. Nur die vermisste Tochter ist immer noch wie vom Erdboden verschluckt.
Michael Farris Smith wühlt tief in der Seele zweier Menschen, die sich niemals suchten. Als sie sich fanden, konnten sie ihr Glück nicht fassen. Nun wurde ihnen das Wichtigste genommen, das ihnen je passiert ist. Zu keiner Zeit driftet er in den Schlund des Kitsches ab. Niemals rühren Tränen den Leser derart, dass er losrennen und Jennifer selbst suchen möchte. Als Leser ist man Unbeteiligter, und das ist ausnahmsweise etwas Gutes. Man beobachtet wie zwei Menschen sich immer weiter voneinander entfernen, ohne jemals loszulassen. Estelle und Jon sind wie entfernte Freunde, deren selbst auferlegtes Schicksal man nicht teilen möchte. Und sie um Himmels Willen nicht stören möchte. Hier sind zwei Menschen am Werk, die sich niemals mit dem zufrieden geben werden, was ihnen angeboten wird. Sie verschließen sich der Welt und entfernen sich voneinander, um im Moment des Sieges alle und alles in den Arm zu nehmen. Der Weg ist steinig, dornig und voller Fallen. Michael Farris Smith lindert mit faszinierenden Gedankenspielen die Schmerzen.