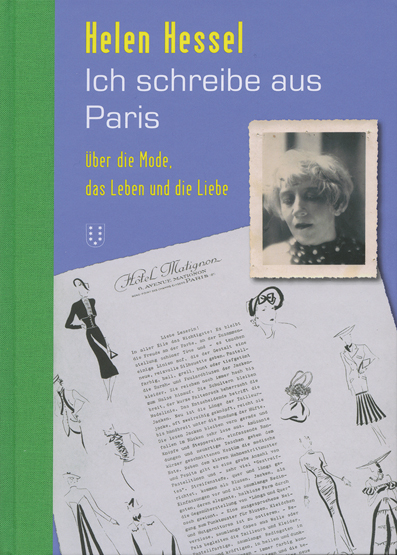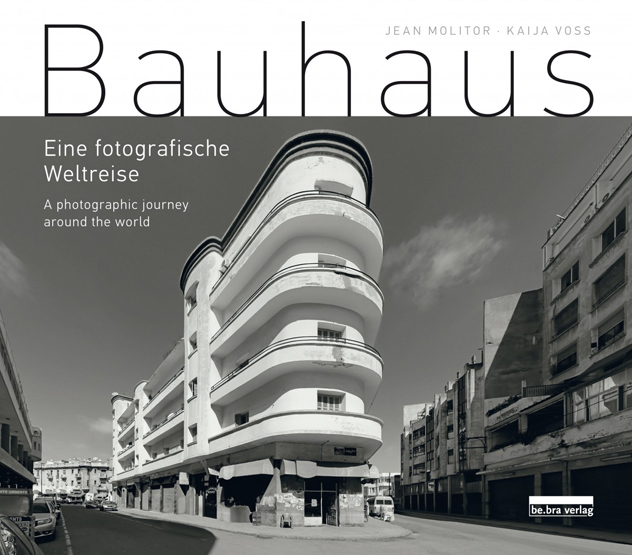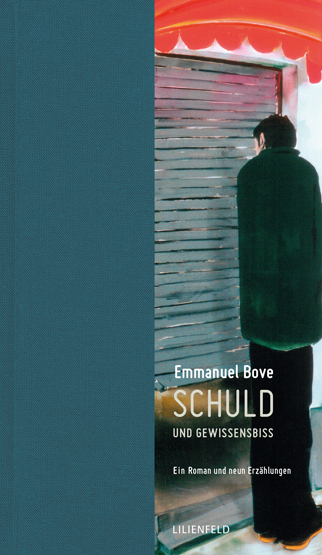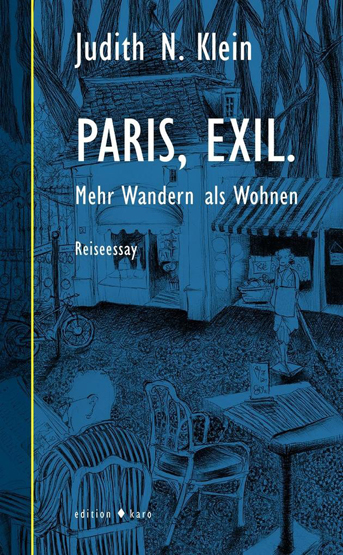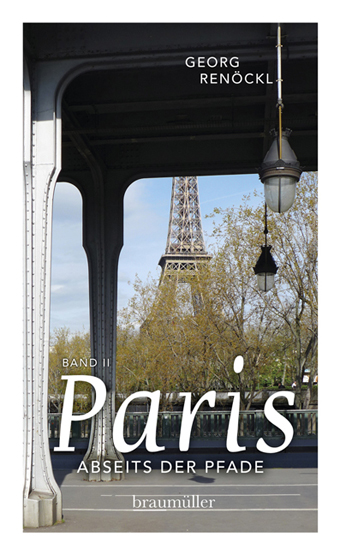Der Titel erinnert ein wenig an einen 90er-Smash-Hit: MMMM. Die Crash Test Dummies bestimmten über Wochen die Starre in zahlreichen Charts. Dieses Buch hingegen wird viel länger nachhallen. Zum ersten Mal sind die vier Romane „Sich lieben“, „Fliehen“, „Die Wahrheit über Marie“ und „Nackt“ in einem Band erhältlich, mehr als dreißig Prozent mehr als so manche Leckerei.
Sich lieben
Marie Madeleine Marguerite de Montalte ist eine Künstlerin wie sie im Buche steht. Als Modedesignerin ist sie weltweit begehrt und gebucht. Der anonyme Erzähler und Marie sind ein Paar. Aber eigentlich auch wieder nicht. Es ist kompliziert. Eben noch im Taxi in Paris – Marie in Tränen aufgelöst / er hilflos und sorglich zurückhaltend – wissen beide, dass das Licht am Ende des Tunnels ein Zug ist, der mit brachialer Gewalt ihrer Zweisamkeit den Garaus machen kann. Und wird. So wie schon einmal. Damals in Tokio.
Marie war eingeladen eine Ausstellung mit ihren Werken zu organisieren. Tokio sollte nicht der Anfang einer großen liebe werden, vielmehr sollte er das Ende besiegeln. Da war sich der Erzähler sicher. Denn wenn Marie ihn so nah an sich ranließ, verhieß das nichts Gutes.
Es ist eine verrückte Liebe zwischen dem Erzähler und Marie. Mit Wohlwollen nimmt der Leser zur Kenntnis, dass zwar Marie das Objekt der Begierde ist, aber nur der Erzähler sich und seine Beziehung analysiert. Er vermeidet es Marie unter die Lupe zu nehmen und zu sezieren. Jean-Philippe Toussaint könnte es, schließlich sind Erzähler und Marie seiner Phantasie entsprungen, doch das Kribbeln der beiden soll auf den Leser überspringen. Und das tut es mit vehementer Direktheit.
Die Szenen wechseln zwischen brutalen Phantasien – der Erzähler hat sich eine Flasche mit hochprozentiger Salzsäure zu gelegt – und wildem Deckengwühle, das bei aller Schamlosigkeit niemals ins Ordinäre abgleitet, umrahmt vom Gedankenspiel des Erzählers. Marie, die Unnahbare, die Unfassbare, die Wechselvolle verschwindet immer mehr hinter dem Schleier der Ungewissheit. Man möchte nur noch …
Fliehen
Der Erzähler ohne Namen und Marie haben das UND aus ihrer beider Leben gestrichen und gehen beide nun getrennte Wege. Sie in Paris, er in China. Ein bisschen Ablenkung sollte guttun. Shanghai frisst ihn auf, genauso wie die ständige Überwachung in der Millionenmetropole. Im Zug nach Peking lernt er Li Qi kennen. Im Gegensatz zu Marie ist Li Qi unkompliziert, und prätentiös und … willig. Und eine willkommene Abwechslung zur ständigen Anwesenheit des Überwachungshundes, der seit der Landung in Shanghai nicht von der Seite weicht. Marie hatte den Erzähler gebeten einen Umschlag bei dem Überwachungstier anzugeben. Und nun wird er ihn nicht mehr los.
Gerade als so etwas wie Alltag in die Urlaubsreise einkehrt, durchbricht das enervierende Bimmeln des Telefons die Erholungs- und Eingewöhnungsphase. Marie ist dran, ihr Vater ist gestorben. Gedankenlos lauscht er mehr oder weniger konzentriert ihrem Schmerz. Keine Tränen, keine Rührung ist zu vernehmen. Aber die Tatsache, dass Marie ihn, der tausende Kilometer entfernt ist, anruft, um die traurige Nachricht mit jemandem teilen zu können, lässt ihn wachbleiben.
China ist für ihn ein echtes Abenteuer. Verkehrschaos wechselt mit exotischer Küche, geschäftiges Treiben geht mit fremdanmutender, barscher Vehemenz Hand und Hand und überall wird man überwacht. Nur Marie macht der Neugier einen Strich durch die Rechnung. Ihr Anruf schlägt ihm auf den Magen. Selbst Li Qi kann ihn nicht mehr recht aufmuntern, was ihr nicht verborgen bleibt.
Zurück in Frankreich ist die Distanz zwischen Marie und ihm größer denn je. Er war nicht da, als sie ihn brauchte, als die Nachricht vom Tode ihres Vaters sie wie ein Blitz traf, der sie erstarren ließ. Doch beide wissen, dass er ein viel größerer Störfaktor gewesen wäre, wäre er greifbar gewesen. Es ist das alte Spiel: Sie können nicht ohne einander, und miteinander können sie noch viel weniger. Marie wird immer geheimnisvoller. Wird er sie je erfahren, …
Die Wahrheit über Marie
Die Wahrheit in der Liebe ist nie einfach. Nicht einfach zu erklären, nicht einfach zu verstehen. Oder ist es die Logik, die so schwer zu greifen ist? Marie und der Erzähler sind (wieder einmal / immer noch) kein Paar. Räumlich sin sie sich so nah wie selten in der jüngeren Vergangenheit. Sie sind sich treu und auch wieder nicht. Während er mit Marie schläft, also einer Frau, die ebenfalls Marie heißt, vergnügt sich Marie, die die er eigentlich liebt, aber …, mit Jean-Christophe de G. Plötzlich über kommt sie die Müdigkeit. Sie gibt nach, Jean-Christophe de G. auch. Nur anders. Er kippt um, kaum spürbarer Puls. Wie soll es anders sein: Marie bittet ihn, den namenlosen Erzähler, ihren Rettungsanker in allerlei prekären Situationen um Hilfe. Im strömenden Regen eilt er durch die Pariser Nacht. Marie! Endlich wieder Marie. Endlich ist sie wieder bei ihm! Doch Grappa und Blut – eine wunderbare Kausalkette, die Jean-Philippe Toussaint Marie ins Hirn pflanzt – lassen ihn aus seinen Träumereien und Hoffnungen herausplumpsen.
Jean-Christophe ist tot. Seine Familie lässt eine Traueranzeige in den Tageszeitungen schalten und der namenlose Erzähler, der sich so sehr mit Marie verbunden fühlt, weiß nun, dass der Tote ein ganz anderer war. Marie zieht sich in ihrer Trauer nach Elba zurück, auf den Familiensitz. Dort verstarb vor einem Jahr ihr Vater. Ihr zur Seite stand damals wie heute er, der treue Freund, Geliebte und Weggefährte. Doch mehr als „nur ein paar Spielereien“ wird es auch dieses Mal nicht geben. Sie will das so, er weiß es und ergötzt sich an ihrem Anblick. Denn sie ist …
Nackt
Er und sie, also der namenlose Ich-Erzähler und Marie, kennen sich in. Und auswendig. Zusammen waren sie schon, getrennt sind sie immer noch. Die Zwischenspiele haben in ihnen eine Freundschaft erwachsen lassen, die, wenn mehr daraus werden soll, in einer Katastrophe enden wird. So hat es jedenfalls das wahre Leben vorgesehen. Doch Marie und er sind nicht von dieser Welt. Sie ist die erfolgreiche Designerin, die Models in Honigkleidern und in Dornengewächsen über die Laufstege, die eher Museen gleichen, schreiten lässt. Er hingegen sieht sein Lebenselixier darin Marie zu beschreiben und für sie im Falle eines Falles da zu sein. Nicht einfach nur verfügbar, sondern wahrhaft da.
Seine Odysseen führten ihn, zusammen mit Marie nach Tokio, allein nach China und zu ihr nach Elba. Zuhause sind beide in Paris. Nur wenige Schritte voneinander entfernt leben sie ihr Leben einsam mit dem Anderen im Kopf. Waren sie bis vor ein paar Jahren nackt, so hieß das Schwitzen bis zur Besinnungslosigkeit. Heute ist ihre Nacktheit eine symbolische Nacktheit. Sie kennen sich wie s nur Freund tun. Marie hat in der Vergangenheit so manchen ihrer vermeintlichen Freunde z Grabe tragen müssen. Auch ihren Vater. An ihrer Seite war stets der namenlose Freund und einstige Liebhaber. Es wird Zeit für ein Happy end…
Jean-Philippe Toussaint lässt seine beiden Helden knapp sechshundert Seiten vier Romane lang leiden, lieben und durch das Fegefeuer der Abwegigkeit waten. Wie die zwei Königskinder ist ihnen das Schicksal der Alleinbewältigung des Lebens vorbestimmt. Mit bisher nie gekannter Wortgewalt schwappt dem Leser die komplette Portion Leben ins Gesicht. Der namenlose Ich-Erzähler verzehrt sich nach der selbstbestimmten Marie, beide spielen ihre Rollen gut. Doch nicht gut genug, um schlussendlich einen – den richtigen – Entschluss zu fassen: Was viermal währt, wird endlich gut!