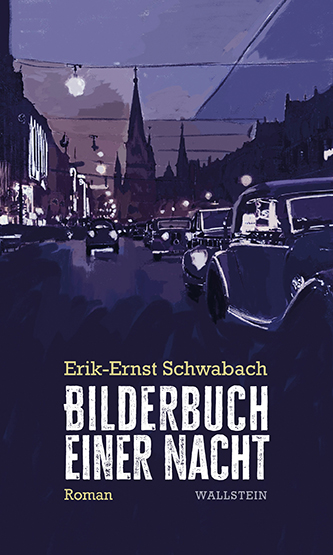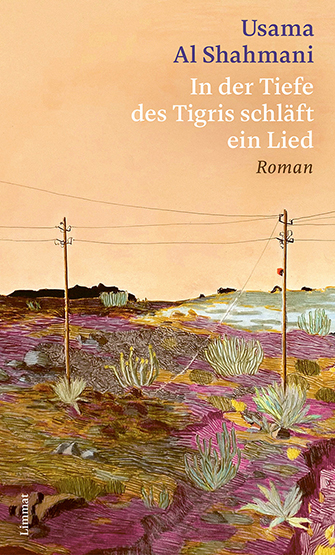Es ist unbestritten, dass Paris zu den Top 10 der Sehnsuchtsorte auf der Welt gilt. Das belegen allein schon die Besucherzahlen. Zum Anderen sind es aber auch die unzähligen Bücher, die über die Stadt geschrieben wurden und der Berg an Büchern, deren Handlung ohne Paris nur halb so interessant wäre.
Gernot Gad geht es sicherlich nicht anders – der gebürtige Berliner lebt in Paris. Nicht weil er muss, sondern weil er es will. Weil die Stadt ihn fasziniert. Es saugt die Stadt auf, atmet ihren Rhythmus ein und stromert mit wachem Auge von Links nach Rechts. Dabei quert er die Seine ein ums andere Mal. Es scheint schon fast logisch, dass er den Brücken, die ihn übers Wasser tragen, ein Denkmal setzen muss. Und was für eins!
Kaum eine romantische Szene kommt ohne die Brücken von Paris (am besten bei Nacht oder zumindest bei Anbruch der Nacht) aus. Das Lichtermeer ist schmeichelnd für das Auge. Mit Eiffelturm im Hintergrund – ebenfalls beleuchtet – und schon hat man das perfekte Erinnerungsbild für die Ewigkeit. Kitschig. Ein bisschen. Aber auch umwerfend beeindruckend. So muss Paris in der Erinnerung sein!
Ist der erste Rausch verklungen, drängen die ernsten Fakten nach vorn. Siebenunddreißig Brücken sind es die Paris die Trennung durch die Seine vergessen lassen. Pont Neuf ist wohl die bekannteste in einer zeit, in der das schnelle eindrucksvolle Foto mehr Wert besitzt als die nie verblassende Erinnerung an eine schöne Zeit. Juliette Binoche setzte im gleichnamigen Film dieser Brücke ein ewiges Denkmal. Filmgeschichte zum Anfassen bzw. zum darauf Herumlaufen. Diese Brücke allein für sich zu habe, ist unmöglich.
Aber da sind ja noch sechsunddreißig weitere Brücken. Und ihre Geschichte teilt Gernot Gad mit dem Leser. Hochzeitspaare an einer Brücke, die an den Krieg in der Wüste erinnert – wenig romantisch. Doch Monsieur Eiffels Vermächtnis im Hintergrund lässt all die Pein vergessen. Das Licht muss nur stimmen.
Pont Grenelle – dort, wo die Freiheitsstatue in kleinerer Ausführung steht – raunt man sich Legenden zu. Hier das Original, da die überlebensgroße Kopie. Von wegen. Umgekehrt ist es richtig. Hier wird Geschichte fasst schon greifbar. Besonders, wenn man sich das Gesicht der Dame auf der Brücke anschaut. Frédéric Auguste Bartholdi hat die Statue geschaffen. Das Gesicht war ihm wohl bekannt. Es ist das Gesicht seiner Mutter. Und eigentlich sollte sie schon Jahrzehnte vorher in der warmen Sonne Ägyptens stehen…
„Über die Brücken von Paris“ ist genau das Buch, das man braucht, kennt man die Stadt schon gut. Sind die Märkte wie der heimische Supermarkt, ist der Eiffelturm nicht mehr Objekt des stundenlangen Wartens auf überragende Aussichten, ist Montmartre nicht länger das verblassende Klischee des Paris von einst, sind die Modeläden in Le Châtelet nur Fassaden, die man gern noch im Augenwinkel wahrnimmt – dann wird es Zeit sich neue Ziele in Paris zu stecken. Von A bis A, von Aval bis Amont, das ist schon eine ordentliche Wegstrecke, die man da zurücklegen muss. Immer am Ufer entlang. Und in der Mitte des Weges ganz schön voll. Und doch nimmt man all das auf sich, um in Paris doch etwas zu erleben, was Andere niemals wahrnehmen werden – so lange sie nicht dieses Buch mindestens in der Hand halten – Paris ist ab sofort eine ganz andere Stadt!