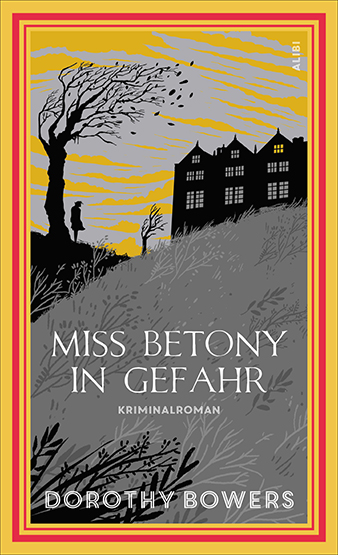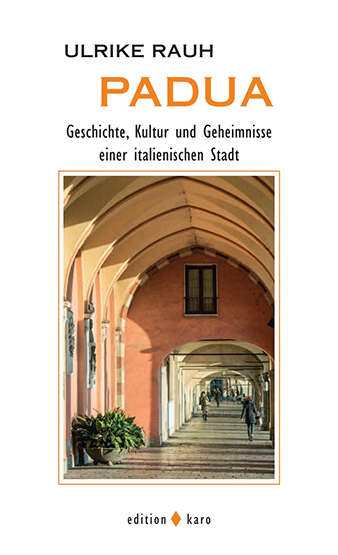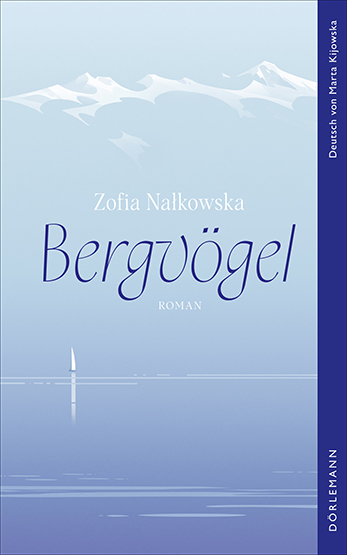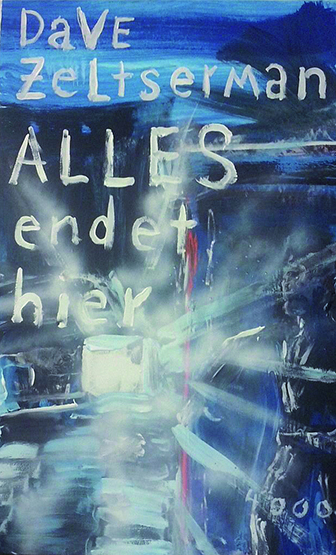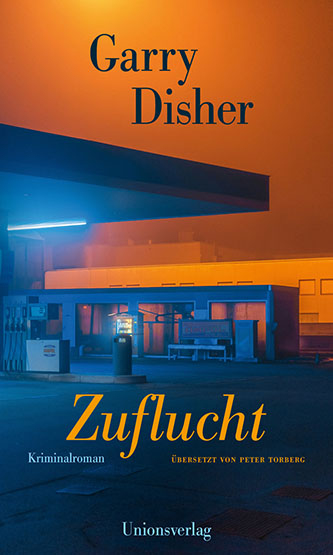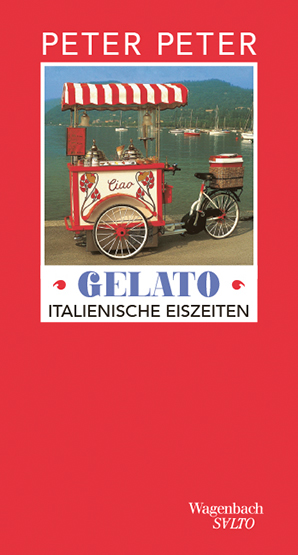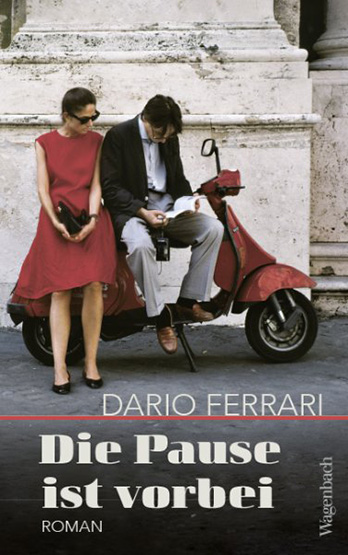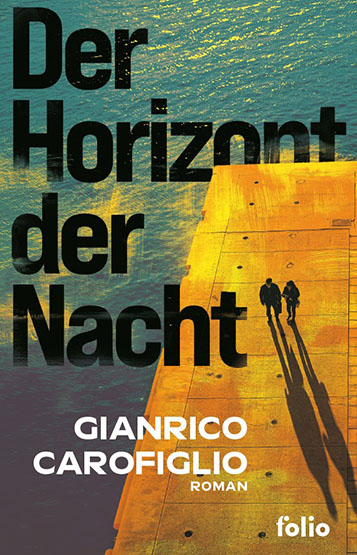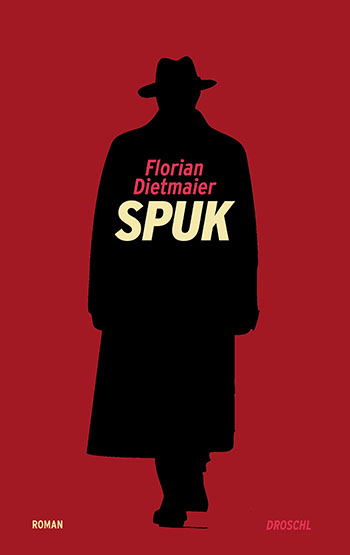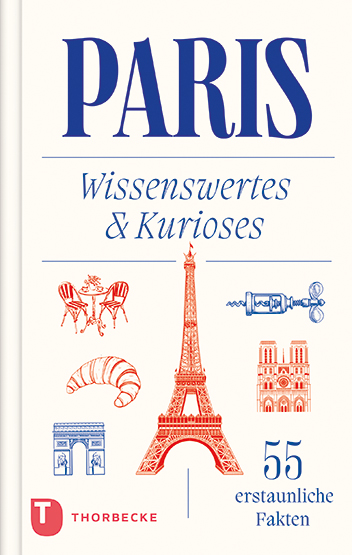Das ist doch nett: Eine ehemalige Schülerin bittet ihre ehemalige Lehrerin bei ihr – im Internat – zu wohnen und ihren Lebensabend anständig und wie es sich gehört zu genießen. Oberflächlich eine wirklich noble Geste. Doch wie so oft im Leben, hat alles einen Haken.
Emma Betony ist eine ehemalige Hauslehrerin Emma Betony, die sich sehr darum bemühte ihren Ruhestand in einer Seniorenresidenz genießen zu können. Das „Aufnahmeritual“ gestaltet sich schwierig, da ihre Herkunft nicht ganz dem Standard entspricht, den sich das Haus wünscht. England und Standesdünkel – eine ganz eigene Welt…
Die Einladende ist Grace Aram, mittlerweile selbst Leiterin eines Internats, in dem auch ein Pflegeheim untergebracht ist. Für Miss Betony – Emma – verlockend, aber auch nicht besonders erstrebenswert zugleich. Denn Kinder waren für sie nie (wirklich nie!) erstrebenswerte Wesen, die sie gern um sich hatte. Sie zu formen, war okay. Aber sie stets um sich herum zu haben – no, thanks. Und außerdem hat Emma nun doch die Zusage für Toplady bekommen, der Seniorenresidenz, für die sie sich beworben hat. Doch Grace`Angebot ist dann doch verlockender. Schließlich ist sie die einzige ehemalige Schülerin der Gouvernante, mit der sie noch regelmäßig in Kontakt steht. Man konnte es schon fast Freundschaft nennen.
Grace hat einen konkreten Anlass Emma zu bitten zu ihr zu kommen. In dem Pflegeheim, das unterm gleichen Dach wie ihr Internat ist, wird – aller Wahrscheinlichkeit nach – ein perfides Spiel getrieben. Eine Bewohnerin wird sukzessive … vergiftet. Ja, so ist das in englischen Pflegeheimen! Emma hat nun die Wahl: Entweder so den Lebensabend beschließen wie geplant oder doch der vermeintlichen Freundin zur Seite stehen und ein bisschen Nervenkitzel zu erleben. Emma entscheidet sich für Letztes.
In dem Internat, das Grace leitet, ist alles seltsam. Nettigkeiten weichen Ränkelspielen, Lehrkörper und Schüler sind im ständigen Wettkampf. Emma, Miss Betony, muss sich erstmal eingewöhnen. Dabei hilft ihr ihre über Jahrzehnte gepflegte Distanz. Erst als der mysteriöse Ambrosio auf der Bühne der Unannehmlichkeiten erscheint, verliert Emmy Betony ihre Distanziertheit. Doch da ist es schon fast zu spät, und schon ist „Miss Betony in Gefahr“.
Dorothy Bowers gehört zu erweiterten Kreis englischer Ladies, die mit ihren Krimis die Welt eroberten. Während Dorothy L. Sayers und Agatha Christie nie auch nur eine Silbe ihres Ruhmes verloren gaben, wird Dorothy Bowers immer wieder neu entdeckt. Dieses Buch wird jetzt, 2026, zum ersten Mal auf Deutsch erscheinen, 85 Jahre NACH Erscheinen. Gift, Intrigen, destinguished people – alles, was das british-crime-heart begehrt wird hier vollends bedient, ohne dabei auch nur ansatzweise im Klischee-Morast zu versinken.