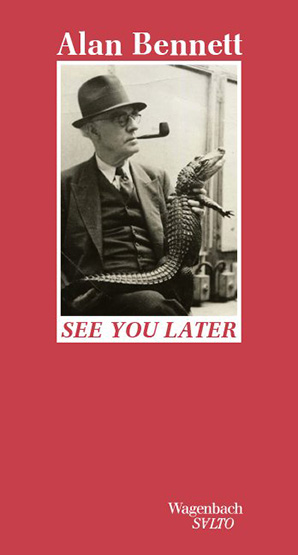Wer hat noch Erinnerungen an die Coronazeit? Alles stand still, Freunde treffen war unmöglich, Maskenpflicht, Zugangsbeschränkungen im Supermarkt. So wird man noch in Jahren darüber sprechen. Für einige war es eine furchtbare Zeit, für einige Andere eine annehmbare Zeit und für einige Wenige war es halt so – kann man nicht ändern – aber Einschränkungen? – Nö!
Hill Topp House, Seniorenresidenz. Auch hier wird Corona bald schon über die Bewohner und Mitarbeiter hereinbrechen. Hier ist alles durchorganisiert. Der wöchentliche Sherry, der Ausflug zum Flamingo (nicht fragen, einfach hinnehmen – göttlicher Humor wie es nur einem Alan Bennett gelingen kann) – die Routine lässt jede Sekunde kontrolliert (to control, engl. – steuern) verrinnen.
Doch die Bewohner wissen sich zu helfen, sich den Normen und Regeln entgegenzustellen. Aber sie wissen auch, dass wer sich nicht an die Regeln hält, Low Moor blüht. Low Moor ist das Gegenteil von Hill Topp House. Das ist keine Residenz, es ist … low. Und so neckt man sich hier und da. Füllt die Zeit mit Puzzles. Einer ist so keck, dass man immer auf der Hut sein muss, dass er nicht – mehr oder weniger plötzlich – die Hose runter lässt. Die Erinnerungen an ihr aktives Leben sind gemeinsames Gesprächsthema. Auch wenn die Erinnerungslücken mit reichlich Phantasie gefüllt werden (müssen).
Und es ist ein Kommen und Gehen. Alan Bennett schreibt mit rührender Ironie und Respekt über eine kleine Gruppe von Menschen, deren Aktionsradius mit allerlei „Annehmlichkeiten“ reguliert ist. Zu behaupten sie lebten in ihrer eigenen Welt, würde am Ziel vorbeigehen. Obwohl es faktisch so ist. Als das Virus das Land, den Kontinent, die Welt erfasst, sind sie insgeheim froh so abgeschottet leben zu dürfen. Sie wissen, dass es anderswo nicht so sicher sein kann.
Das angeschlossene Tagebuch des Autors ist real, und weit weniger ironisch. Auch Alan Bennett machte sich Gedanken wie das Virus die Welt, seine und die da draußen, verändert. Homeoffice, wenn möglich. Doch, wo es nicht möglich war, übernahm die Ohnmacht die Leitung. „See You Later“ ist keine Abrechnung mit fragwürdigen Entscheidungen von ratlosen Entscheidungsträgern. Es ist im ersten Teil, dem, der Hill Topp House als Spielwiese hat, eine zuckersüße Betrachtung. Im zweiten Teil, dem Tagebuch des Autors kehrt eine Zeit zurück, die nur dem Namen nach noch irgendwie präsent scheint. Und so lange man sich später noch sehen konnte, war in der Nachbetrachtung alles … tja, was war es denn nun?!