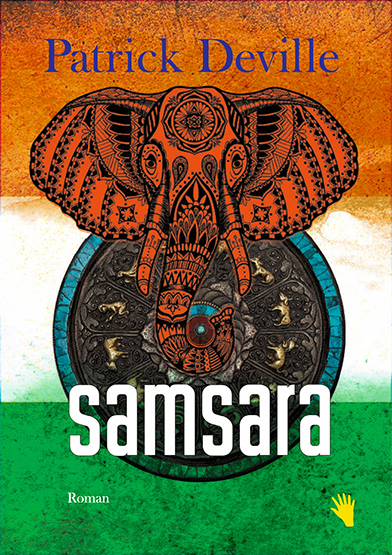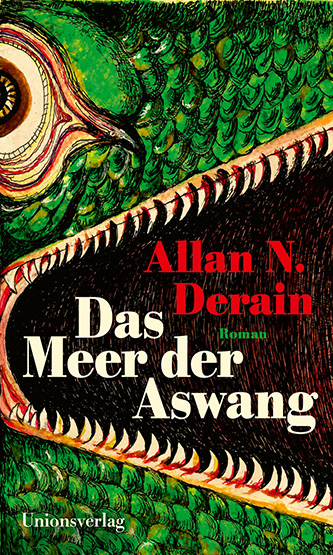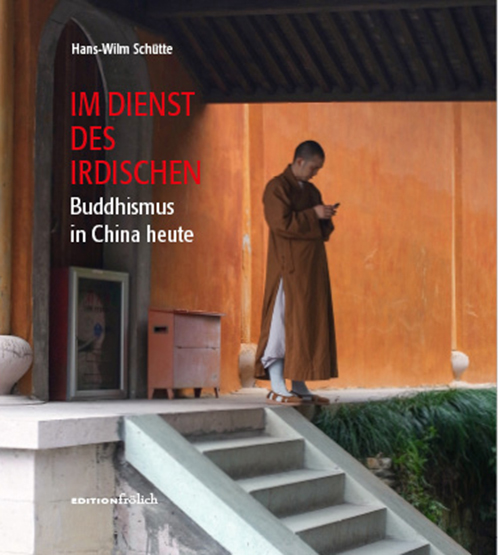Das historische Setting ist bekannt: Die Unabhängigkeitsbewegung Indiens. Die handelnden Personen sind weltbekannt und teilweise unbekannt. Der Eine ist zum Begriff des gewaltlosen Widerstandes geworden. Trug stets weiß und eine Brille. Und er starb durch eine Kugel. Mahatma Gandhi. Der Andere musste wegen des Kampfes gegen die britischen Besatzer seine Heimat verlassen, ließ sich in den USA zum Agronomen ausbilden, bereiste den Erdball, lebte in Mexiko und starb friedlich in seinem Zuhause. Pandurang Khankhoje ist sein Name und selbst das deutschsprachige Wikipedia findet nur Seiten, in denen sein Name vorkommt.
Patrick Deville, der Weltreisende mit ausgeprägtem Hang zu Geschichte(n) erzählen, nimmt sich dieser beiden Figuren der Weltgeschichte an. Bei seien Recherchen machte ihm vor allem die Corona-Situation zu schaffen, in jeder Hinsicht. Ein weiteres Mal gelingt es ihm scheinbar spielerisch biographische Daten und Anekdoten zu einem festen Stoff zu verweben, der keinerlei Kritik an sich heranlässt.
Mal taucht ein Kämpfer auf, der nur mit Mühe marodierenden Schergen entkommt. Mal ist es eine russische Autorenikone, die geschickt mit dem Leben (in diesem Falle Gandhi) verwoben wird. Stets korrekt und niemals blind dem Effekt hinterher haschend. Das ist das Erfolgsrezept der Bücher von Patrick Deville, dessen Bücher die Weltengeschichte so einzigartig dem Leser näher bringen.
Der indische Unabhängigkeitskrieg wird bildhaft immer nur als langer Marsch ohne Gewalteinsatz dargestellt. Da lief einer vorneweg, der Gewaltlosigkeit und zivilen Ungehorsam predigte (und vorlebte) und somit das Bild eines ganzen Landes – und mittlerweile von mehr als einer Milliarde Menschen – immer noch prägt. Wie es dazu kam, wird selten bis niemals erläutert. Mit einer Whatsapp-Gruppe wird er das wohl niemals geschafft haben…
Pandurang Khankhoje ist hingegen kaum bekannt. Kampf hatte für ihn etwas mit Krieg zu tun. Waffen waren durchaus eine geeignete Wahl. Sein Er und Gandhi verfolgten dasselbe Ziel. Ein freies Indien, das sich geeint eine sonnige Zukunft selbst aufbaut.
Dieser historische Roman – ein reines Sachbuch ist „Samsara“ nicht – nimmt den Leser in die Hand in eine fast schon unbekannte Welt. Drückende Hitze, längst vergangene, verschwommen wirkende Zeiten und der enorme Faktenreichtum locken den Leser durch die präzise Sprache in historische Zukunftsvisionen, die wie Seifenblasen zerplatzt sind. Patrick Deville ist wie der Großvater auf dessen Schoß man sitzt und dem man unendlich bei seinen Geschichten zuhört. Das sanfte Wippen der Schenkel ist das Umblättern im Dickicht des Unwissens. Und der Duft der Ahnen wird dem umschriebenen Duft des unbekannten Landes gleich gesetzt. „Samsara“ ist wie eine historische Science-Fiction-Saga, der man sich nicht entziehen kann.