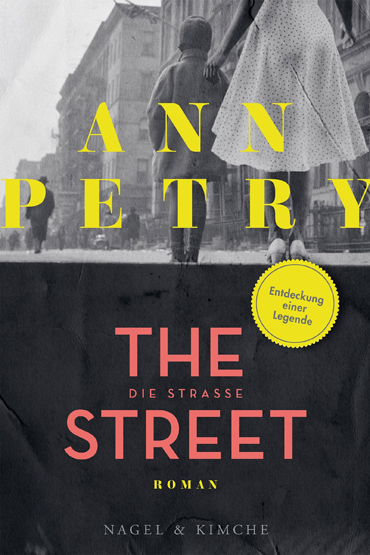Perla – kein Kosename für die Angebetete. Sondern ein Name für eine Frau, deren Schicksal gar nicht glänzend war. Sie ist die Mutter des Autors Frédéric Brun. Erst nach dem Tod der Mutter traut sich Brun sich ihr und ihrem Schicksal zu nähern. Perla war in Auschwitz! Und sie überlebte! Was sie nie vollends überwinden konnte!
Für Frédéric Brun ist es immer noch schwer zu verstehen, dass in einem Land, aus dem so viele von ihm verehrte Dichter kamen so viele Henker hervorbringen kann. Er schafft Parallelen und bringt sie im gleichen Moment zum Einsturz. Er lässt Caspar David Friedrich auferstehen und schüttelt den Kopf, wenn er schreibt, dass Hölderlin von Auschwitz-Insassen wie Erbauern gleichermaßen geliebt wurde.
Ein besonders nachhallender Vergleich ist der von Josef Mengele, dem KZ-Arzt in Auschwitz, der im Exil im Meer ertrank und seinem noch ungeborenen Sohn Julien, den er in einem wohligen Meer im Bauch der Mutter heranwachsen lässt. Ein Vergleich, der nur Phantasievollen naheliegt, und den Leser ins Herz trifft. Und den Leser im Mark erschüttert. Perversion und Unschuld in einem Kapitel – das prägt das Bild dieses Buches. Denn dieser Josef Mengele war es, der mit einer Handbewegung Perla das Leben rettete. Eine perfide Vorstellung, denn ein Leben in Auschwitz war nicht mit menschlichen Maßstäben messbar.
Frédéric Brun kleidet Gedankenblitze und Erinnerungen an seiner Mutter unaufgeregt mit wohl platzierten Worten aus. Die Wucht der Bedeutung der Worte fegt jeden um, die Poesie der Sprache hebt jeden sanft an. Nun kann man sich wie in einem spannenden Krimi durch dieses Buch lesen. Man kann aber auch Zeile für Zeile aufsaugen. Letzteres ist auf alle Fälle empfehlenswert. Es lohnt sich dem Wohlklang der Worte hinzugeben. Ein weiteres Leben wird diesen Worten durch Christine Cavalli, die Übersetzerin, eingehaucht. Mit Sicherheit keine leichte Aufgabe, da jedes Wort sehr persönlich ist und von Erinnerungen geformt wurde. „Perla“ ist eine echte Perle. Und der Auftakt einer Trilogie.