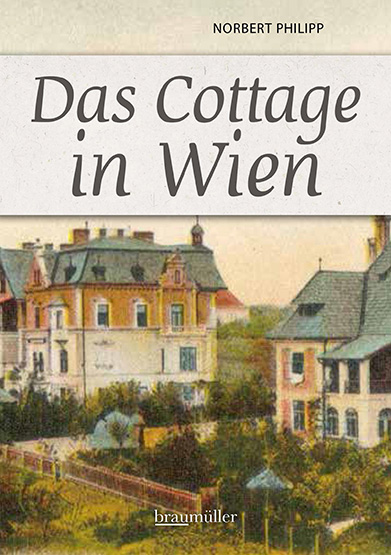Ja, so ein Cottage in Wien – da lässt’s sich gut leben. Das dachte man sich auch vor mehr als einhundertfünfzig Jahren. Und vor genau einhundertfünfzig Jahren gründete sich der Wiener Cottage Verein. Die Stadt wuchs, wurde aber nicht attraktiver. Als Kaiserstadt natürlich nicht hinzunehmen! Stadtplanerisch orientierte man sich an Paris, Baron Haussmann krempelte die Stadt gerade gehörig um. Stilistisch war man eher in London und England fündig geworden.
Ein ganzes Viertel – damals noch – vor den Toren der Stadt. In Währing, heute der 18. Bezirk von Wien, gleich hinter Alsergrund, wenn man sich von der Donau entfernt. Die Türkenschanze war ein Quartier, von der aus die Belagerer von einst, die Türken, die Stadt ganz gut im Blick hatten. Und hier sollte nun der Wohnungsnot, dem Staub und Gestank der Stadt (immerhin schon eine halbe Million Einwohner) Einhalt geboten werden.
Einzeln stehende Häuser sollten es sein. Viereckiger Grundriss. Zwei Etagen. Und niemand durfte den Blick des Anderen versperren. Oder hier ein die Sinne beeinträchtigendes Gewerbe betreiben. Es sollte also nicht stinken, so wie in der Großen Stadt „da unten“.
Wer heute durch Wien schlendert, tut sich beim ersten Besuch schwer den Ersten überhaupt zu verlassen. Die Pracht der Gebäude im Inneren und am Ring ist einfach zu überwältigend. Doch sind es nur Minuten Fußweg bis in den Achtzehnten. Und schon ist man im „Koteesch“, im Cottage-Viertel. Arthur Schnitzler hat es hier hin verschlagen, „Bambi“ wurde hier auf die Welt gebracht. Historischer Boden.
Norbert Philipp beschreibt sehr anschaulich in seinem Buch wie das Viertel entstanden ist und wie es sich stetig veränderte. Hier trifft man mit Sicherheit weniger Touristen in einem Jahr als am Stephansdom an einem Nachmittag. Und mit genau so großer Sicherheit kann man sich hier ebenso wenig satt sehen. Jedes Häuschen ein Unikat. Nur auf den ersten Blick ähneln sich die Zweigeschosser. Wer innehält, erkennt auch ohne fachmännischen Blick die Unterschiede. Es ist grün hier. Ruhig. Gediegen. Nicht ganz so wie in Hietzing in Nähe des Schlosses Schönbrunn, dennoch nicht minder sehenswert. Im Gegenteil, vielleicht sogar etwas abwechslungsreicher. Und hier stehen nicht alle paar Meter Gedenktafeln. Eine Architekturflaniermeile, die man an vielen Tagen ganz für sich allein haben kann. Wenn man weiß, wo man schauen und innehalten muss. Mit diesem Buch ist das kein Problem.