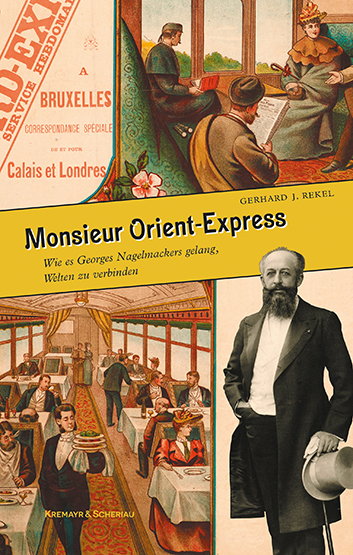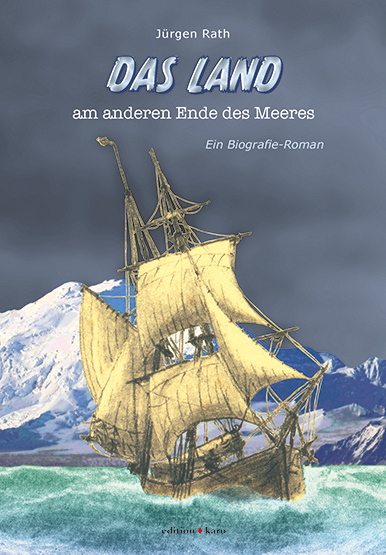Was wären wir ohne unsere Adeligen? Es würde doch sicher was fehlen. Zum Einen ist es wohl die einzige Form sich der Vergangenheit zu erinnern, zum Anderen haftet dem Adel, besonders den Königshäusern immer noch etwas Märchenhaftes an. Dass dem seit über hundert Jahren nicht mehr so ist – zumindest das Märchenhafte – ist jedem klar, wenn er Bilder aus dem demokratisch gewählten Parlament sieht.
Doch was ist eigentlich passiert, dass Könige, Fürsten, Herzöge heutzutage zwar mit ihrem Namen hier und da noch Eindruck schinden können, ihr Einfluss jedoch kaum noch spürbar ist? Es war wie sooft in der Geschichte der Krieg, der alle Hoffnungen auf Fortbestand zunichte machte. Mit dem Ende des Ersten Weltkrieges verschwanden die Königreiche und Fürstentümer von der administrativen Landkarte. Nur noch in den Namen der Bundesländer leben ihre Namen weiter.
Frank-Lothar Kroll zeichnet die Lebenswege der Hohenzollern, der Wittelsbacher, derer zu Braunschweig, den Wettinern und anderen exakt nach und gibt Einblicke in ihr Leben nachdem man ihnen den Thron unter ihrem herrschaftlichen Gesäß weggezogen hatte. Einige überlebten, behielten ihre Besitztümer, fanden neue Betätigungsfelder. Ihre Namen öffneten so manche Tür, die den meisten verschlossen geblieben waren.
Auch wenn man nicht die Artikel in den einschlägigen Magazinen verfolgt, so sind den meisten die vorgestellten Männer und Frauen ein Begriff. Nur wenige – wie das Geschlecht der Reuss – sind für den Leser Fremde, deren Hinterlassenschaften hingegen wohlbekannt sein dürften. Bleiben wir bei den Reuss. Hier gab es zwei Linien: Die Ältere und die Jüngere. Letzte war und ist in Teilen im thüringischen Greiz ansässig. Ein Land so klein, dass – wie im Buch dargestellt – es in einer Karte des Deutschen Reiches wie ein Fehler, ein dunkler Fleck im Papier aussieht. Das Gebiet, das die Ältere Linie besaß, war nur unmerklich größer. Gegen Ende ihrer Herrschaft – da wussten die beiden Häuser aber noch nicht, dass das Ende in Sichtweite ist – war Bismarck ihr Lieblingsgegner. Wann immer sich die Möglichkeit bot, bot man ihm die Stirn. Mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Randnotiz der Familiengeschichte: Jedes der beiden nannte ihre Nachfahren Heinrich, so dass eine erstaunliche Anzahl an X und V und I zusammenkam. Heinrich XLV. Wurde nach dem Krieg ins befreite KZ Buchenwald verschleppt, seitdem fehlt jede Spur von ihm…
Im Gegensatz zum Märchen fehlen fast vollständig die Happy ends in den Lebensläufen der Blaublütigen. Sie wurden Künstler, Mäzene, Unternehmer. Sie blieben Waldbesitzer, Förderer von Kultur, erhielten ihre Besitztümer (manche erst nach der Wende) zurück, engagierten sich in sozialen Bereichen. Auch wenn so mancher Fehltritt bis heute für Schmunzeln oder gar Kopfschütteln sorgt (der kürzlich verstorbene Prinz Foffi und seine Eskapaden die Richtige an seine Seite zu ziehen, war in den 90er Jahren köstliche Lückenfüller im Programm der privaten Fernsehsender), so gehört der Adel zur Geschichte eines jeden Landes. Ob sie nun auf einem prächtigen Sitzmöbel Audienz halten oder im modernen Lehnsessel die Geschicke ihrer Firmen leiten, hat bis heute nichts von seiner Faszination verloren.