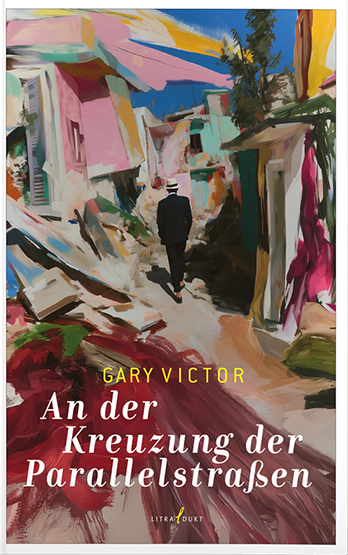Strukturanpassungsprogramm – jeder, den es treffen könnte, ist in erhöhter Alarmbereitschaft. Was nicht heißt, dass ihn dieser Euphemismus nicht trifft. Eric trifft es. Bisher war arbeitete er für den Internationalen Währungsfond in Haïti, der Mitte der 90er – und in dieser Zeit befinden wir uns – das Währungssystem des Inselstaates kontrollieren sollte. Ein Unterfangen, das zum Scheitern verurteilt war.
Eric ist also seinen Job los! Der Minister hat ihn einfach mit einem Federstrich gekündigt. Das ohnehin nicht besonders reizvolle Leben ist noch trister geworden. Eric – der Beamte mit dem sicheren Job – ist zu Eric ohne Zukunft geworden. Von einem Moment zum Anderen, einfach so! Ein Funken Wille glimmt noch in dem vor Wut bebenden Körper. Er wird … ja, was wird Eric tun?
Haïti wird seit Jahrzehnten von Regierungen regiert, die in Wahrheit aber das Land ausplündern und ausbluten lassen. Papa Doc und Baby Doc haben einer ganzen Generation von brutalen Gangstern vorgelebt wie man mit Gewalt ein ganzes Land in Schach hält. Geregelt ist hier kaum etwas. Eric weiß das. Er hat das Elend jeden Tag gesehen, konnte ihm aber aus dem Weg gehen. Er wusste, wer das Sagen hat, wem man am besten aus dem Weg geht.
Jetzt ist er an der Reihe. Jahrelang hat er sich geduckt, seine Arbeit verrichtet. Und wofür? Nicht einmal einen feuchten Händedruck gab’s zum Abschied. Raus, Aus, Schluss, Ende. Der dienstbeflissene Eric wird zum … Eric weiß, wer hinter der Entlassung steckt. Mataro, der Finanzminister. Und der wohnt … Eric weiß ganz genau, wo er wohnt. Er soll ihm Rede und Antwort stehen. Oder besser: Um Gnade winseln. Auf dem Weg gibt sich Eric keine Mühe seine Wut zu verbergen. Was Andere Können, kann er auch! Ein Geldwechsler – arrogantes Gesindel in den Augen Erics – ist sein erstes Opfer. Peng! Einer weniger. Vicky ist der nächste. Mataros Vergnügungsspielzeug. Ein schnippiger Speichellecker, der auch nur versucht sich durchzuschlagen. Es nützt nichts. Die Kugel zerfetzt den smart geschminkten Körper. Nun ist Mataro dran! Endlich Rache. Doch auch der hat einen Einflüsterer. So wie jeder in Haïti, der in gehobener Stellung wirkt. Mit Mataro als Schutzschild und im Schlepptau wird Erics Rachefeldzug zu einem Blutbad unmenschlichen Ausmaßes. Niemand kann ihm den Spiegel vorhalten! Viele versuchen es. Doch das Zerrbild, ficht Eric nicht an. Er ist seines Glückes Schmied, das Eisen trägt er schon in der Hand.
Tief verwurzelter Glaube und die unbändige Wut sind die Pfefferschoten in dieser an sich schon scharfen Mischung aus Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Gary Victor hat den Roman vor einem Vierteljahrhundert geschrieben. Das verheerende Erdbeben, dass das Land einmal mehr wegen einer Katastrophe in die Nachrichten brachte, brodelt noch tief unter der Erde. Die Probleme des Landes nach den Diktaturen der Duvaliers (Papa und Baby Doc) waren damals schon ein unlösbares Desaster. Und sind es bis heute. Das Buch hat seit Erscheinen nichts von seiner Aktualität und seinem Wahrheitsgehalt verloren. Gangs würgen bis heute alles Verwertbare aus dem geschundenen Land heraus. Hilfe von Außen ist nicht zu erwarten. Nur noch größere Gangster, können dem treiben Einhalt gebieten. Eric ist nun wirklich kein Heiliger. Sein Amoklauf ist durch nichts zu rechtfertigen. Ein klein wenig Verständnis bringt man dann doch für ihn auf. Und das ist das Traurige an diesem Buch. Mitleid für Gewalt – das darf es einfach nicht geben!