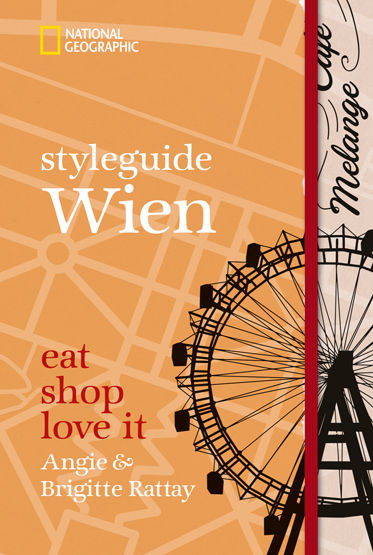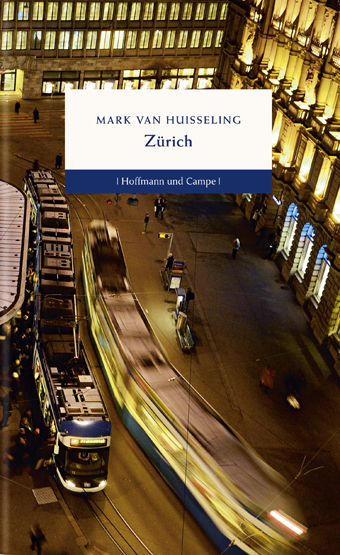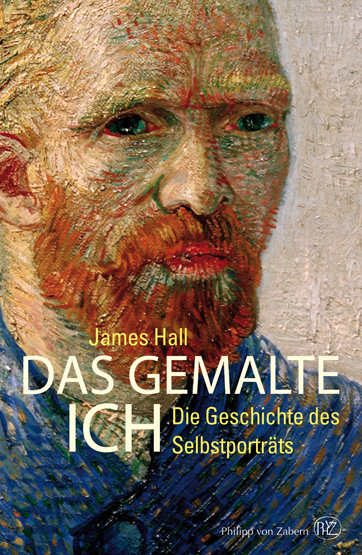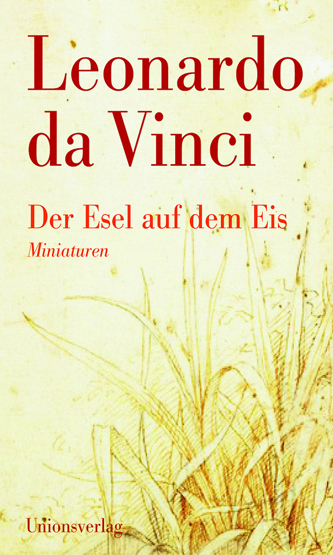Freiheit: Ein wunderbar dehnbarer Begriff, der besonders Politikern, und noch mehr denen, die sich als Politiker fühlen, am Herzen liegt. Kann man so herrlich damit spielen. Und es gibt kaum jemanden, der den Begriff negieren möchte. Gewinner auf allen Seiten.
Freiheit bedeutet auch immer Ausbruch aus der Unfreiheit. Wolfdietrich Jost gibt in seiner Geschichte eine passende Argumentationshilfe. Sein Text „Zu neuen Ufern“ ist der Gewinner des diesjährigen Literaturwettbewerbs „Antho? – Logisch!“ und darf den Reigen der Texte in diesem Buch eröffnen. Sarkastisch und mutmachend zugleich nimmt er die Personalpolitik eines Unternehmens unter die Lupe. Entlassung als Chance?! Entlassung als Chance! Zweieinhalbtausend Mitarbeiter werden auf die Straße, frei gesetzt. Jetzt liegt es an ihnen etwas daraus zu machen. Zynisch? Nein! Er reiht die Fakten aneinander und schafft mit den Mitteln der Literatur eine Freizone der Gedanken.
Die in diesem Buch gesammelten Texte sind Zeilen für den Kopf. Kurz und prägnant zeigen sie die unendliche Gedankenvielfalt zum Thema Freiheit. Der Leser bekommt Zeile für Zeile Bilder vorgesetzt und kreiert seine eigenen Bilder (hinzu). Freiheit ist ein Wort, das oft inflationär gebraucht wird. Es ist individuell und gemeinschaftlich einsetzbar. Jeder hat seine eigene Definition, je nach Tagesform und Situation. Die Freiheit das zu tun, was man machen möchte, ist ein hehres Ziel. Doch genauso flexibel wie ein Gummiband. Freiheit geht immer mit Regeln und deren Einhaltung einher. Wer die Regeln befolgt, hat mehr Freiheiten als der, der sie nicht befolgt. Klingt komisch?
Bricht man den Begriff Freiheit immer weiter herunter, was an sich schon eine Befolgung der Regeln beinhaltet, kommt man schnell zu dem Entschluss, dass die Regeln der Freiheit nicht die Selbige behindern.
„Bilder der Freiheit“ ist für alle, die Freiheit nicht nur als leere Worthülse betrachten. Aus allen Bereichen des Lebens setzen sich die Autoren zusammen. Ihre Ansichten verleiten dazu so manchen Text noch einmal zu lesen. Immer wieder entdeckt man neue Facetten der Argumentation, die man vorher nicht wahrgenommen hat. Man muss sich nur die Freiheit nehmen die Zeilen sich entwickeln zu lassen. Das ist Freiheit in Reinform.