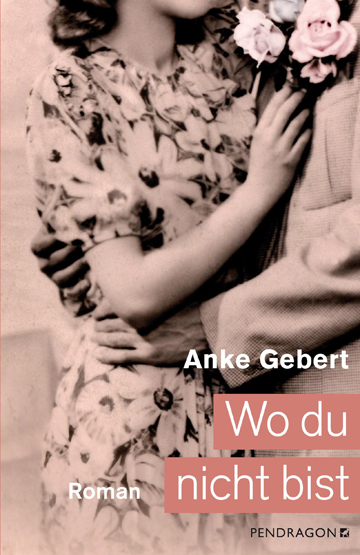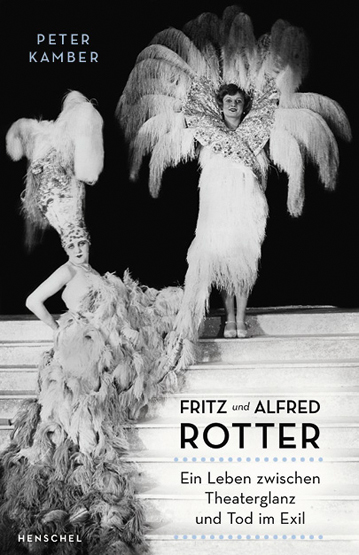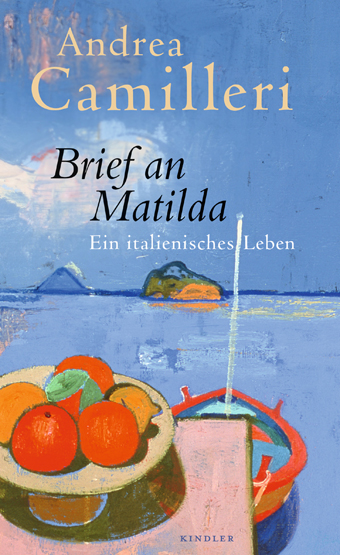Das Pferd würde von der falschen Seite aufgezäumt werden, wenn man behauptet, dass Egon Schieles Charakter seinen Werken entsprechen würde. Die kantigen Konturen erinnern stark an die Wirkung der Bilder, mit denen er Zeit seines kurzen Lebens aneckte. Die explizite Darstellung des Körpers, meist des weiblichen, sorgt bis heute – also über hundert Jahre später – immer noch für zumindest große Augen.
Immer wieder wurde Egon Schiele angefeindet. Doch hinter vorgehaltener Hand fragten sich die meisten Kritiker doch, woher der dünne Schlacks seine Modelle bekam. Schnell verbreitete sich das Gerücht, dass Prostituierte bei ihm ein und ausgingen. Auf Edith und Adele, Schwestern, kennen das Gerücht. Sie wohnen direkt bei ihm gegenüber. Können alles ganz genau sehen. Alles! Wirklich alles! Und Schiele selbst? Auch er hat die Blonde und die Dinkelhaarige schon entdeckt. Er weiß nur nicht wer Edda und wer Adda ist. Eine kleine Notiz ins Haus gegenüber soll Abhilfe schaffen. Der Rest ist verbürgte Geschichte. Aus Edith Harms wird Edith Schiele. Sie und Modell stehen? Niemals! Diese Posen, diese Freizügigkeit – niemals! Adda, Adele ist da ganz anders gestrickt. Ein bisschen älter als Edith ist sie der neuen Kunst nicht unaufgeschlossen. Auch Egon ist nicht ohne Reiz. Doch Egon entscheidet sich für Edith. Sie wird seine Frau. Und Adele seine Muse und Geliebte.
Egon Schiele war als er Edda und Adda kennenlernte, wie umwarb mit Wally zusammen. Auch sie war seine Muse. Und als Gouvernante beim Date mit Adda fast schon so was wie unverzichtbar. Ebenso Moa Nahuimir. Und Gerti. Sie alle waren Egon Schiele zu Diensten. Standen Modell. Waren da, wenn er rief. So expressionistisch seine Arbeiten, so exzessiv war auch sein Leben. Als Künstler trennt man nicht zwischen Leben und Arbeit.
Dem lange verkannten, oft verfemten, angeklagten Egon Schiele war der verdiente Ruhm niemals zugesprochen worden. Erst viele Jahre nach seinem Tod im Alter von 28 Jahren besann man sich seiner. Heute hängen seine Bilder im Museum Leopold und der Albertina in Wien. Der Stadtteil Hietzing, wo er, aber auch Gustav Klimt lebte und arbeitete, Johann Strauss „Die Fledermaus“ komponierte, Franz Schubert starb, Maria Lassing ihr Atelier hatte, Hans Moser herrschaftlich residierte, ist für Kunstliebhaber ein wahres El Dorado. Nur einen Steinwurf von Schloss Schönbrunn entfernt, entfaltet sich hier das künstlerische Wien der vergangenen anderthalb Jahrhunderte.
Egon Schiele und die Frauen ist ein Kapitel für sich. In diesem Fall sogar ein ganzes Buch. Hilde Berger, die auch am Drehbuch zum gleichnamigen Film mitwirkte, lässt einen Exzentriker auferstehen und gibt dem Leser die Aufgabe mit, ob er die Frauen nur ausnutzte oder ob sie selbstbestimmt in den Abgrund rauschten. Denn jede Frau in Egon Schieles Leben wurde auf die eine oder andere Art durch ihn gezeichnet. Wien ohne Schiele ist wie Barcelona ohne Gaudí. Nur schwer vorstellbar und um einiges ärmer. Und Schiele ohne Frauen – das will man sich gar nicht erst vorstellen. Es ist unvorstellbar nach dem Genuss dieses Buches.