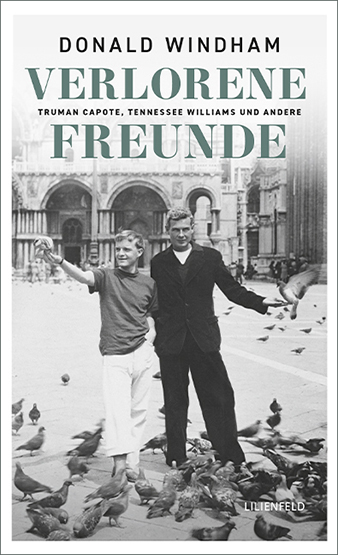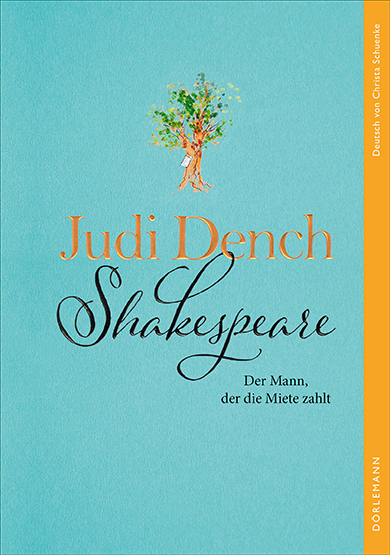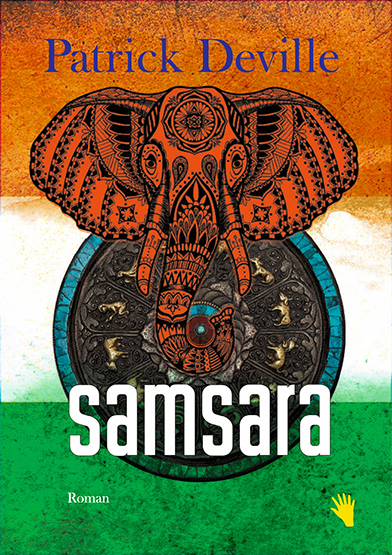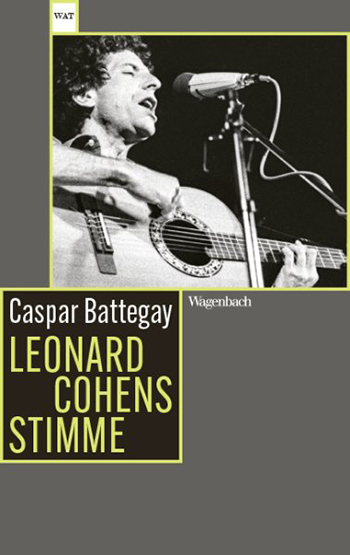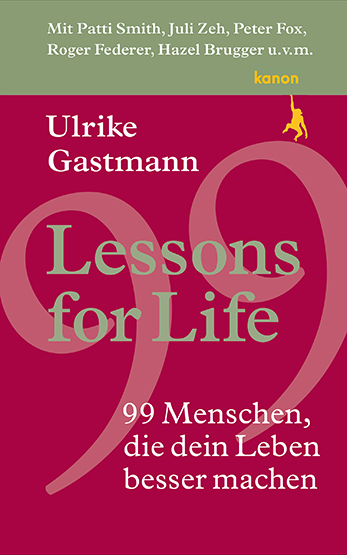Der verzauberte Junge von der Brücke – dieser Untertitel macht neugierig. Wie kann eine Brücke verzaubern? Und warum wird dieser Folker mit F geschrieben? Da hat man das Buch noch nicht einmal auf- und schon ist man in seinen Bann geschlagen.
Folker Bohnet ist sicherlich nicht der bekannteste Name der Schauspieler in Deutschland. Sieht man ihn allerdings, erkennt man ihn umgehend. Dieses jungenhafte Lächeln – dieses immer währende jungenhafte Lächeln – war sein Markenzeichen. Sein Sohn Ilja hat drei Jahre vor dem Tod des Vaters mit ihm Gespräche geführt. Interviews im strengeren Sinne, doch sind es Gespräche zwischen Zweien, die sich so nah stehen wie niemand anderes.
Folker Bohnet wurde 1937 in Berlin geboren, verbrachte die Kriegskindheit in Sachsen, floh mit den Eltern in den 50ern in den Westen. Jurist sollte er werden, Schauspielkunst wurde es schließlich. Als an der Schauspielschule junge unverbrauchte Gesichter für einen Film gesucht wurden, überzeugte er. Der, der suchte, war Bernhard Wicki. Und der Film, für den er suchte, sollte „Die Brücke“ sein. Heute weiß man, dass dieser Film ein Meilenstein ist, und er für viele Schauspieler ein furioser Auftakt für erfolgreiche Karrieren war. Für Folker Bohnet war es bereits sein zweite große Rolle. Kurz zuvor stand er mit einem anderen noch sehr jungen, später sehr erfolgreichen Schauspielkommilitonen vor der Kamera: Götz George.
Es folgte ein wildes Leben, ein erfolgreiches Leben, ein abwechslungsreiches Leben. Schon in jungen Jahren gingen im Hause Bohnet Schauspieler und weitere Künstler ein und aus. Kunst war sein Leben. In jeder Hinsicht.
Es ist die Stille, die in den Worten dieser Biographie liegt, die den Leser so fasziniert. Keine ausschweifenden Gelage und Klatschgeschichten, die hier marktschreierisch zu manchem Skandal breitgetreten werden. Der Grandseigneur hat genossen und erzählt nun aus seinem Leben ohne die Stimmer zu erheben oder mit den Finger auf Andere zu zeigen.
Filmgeschichte, Kunstgeschichte, Künstlerleben – ganz ohne Verbitterung. Das ewige Lächeln im Gesicht war die ebenbürtige Geste zum ewig lächelnden Herzen von Folker Bohnet. Wer dieses Buch – vielleicht wegen der scheinbar fehlenden Prominenz des Namens – liegenlässt, darf sich nicht wundern, wenn er nicht als Film- und Schauspielexperte mehr angesehen wird.