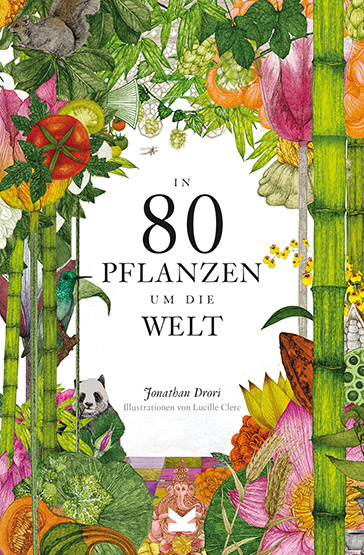Ab Hausnummer Eins immer weiter den Schlammpfad runter. Vorbei an den Windmühlen und dem umgestürzten Gartenzaun und schon ist man auf der Straße, auf der Maurer ihrer Phantasie freien Lauf lassen konnten. Noch ein Stück weiter und dann hört man schon die Massen sich amüsieren, wenn sie die größte Wasserrutsche Europa hinuntersausen. Das ist der Ku’damm. Nein, das war der Kurfürstendamm. Ein Schlammweg mit Windmühlen. Die große Straße hinaus aus der Stadt Berlin, mitten durch den Vorort Charlottenburg. Heute kaum mehr vorstellbar.
Aber der Ku’damm war halt nicht immer der Prachtboulevard, der er heute ist. Er hat sich entwickelt. Auch und vor allem seine Anwohner und Besucher prägten das Bild. Hier speisten, tratschten, diskutierten, tranken, rauchten, beratschlagten Bertolt Brecht, Max Liebermann, Karl Liebknecht … ach einfach alle, die in Berlin ihr Glück(ver-) suchten.
Regina Stürickow gelingt auf so wunderbare Art und Weise dem ein paar Kilometer langen Stück Asphalt mit diesem Buch immer wieder Leben einzuhauchen.
Und sie weiß so manche Anekdote zu erzählen. Zum Beispiel welche Hausnummern es nicht mehr gibt, und warum. Denn heutzutage beginnt der Ku’damm mit der Nummer Zehn. Die ersten Nummern wurden der Budapester Straße geopfert. Im Kapitel über die 20er Jahre nimmt das Buch so richtig Fahrt auf. Berlin wurde zu Groß-Berlin, zu dem, was es heute ist. Und auf dem Ku’damm feierte man dies mit Champagner-Fontänen, die heute noch für große Augen sorgen.
Wer heute über den Boulevard schlendert, wird vieles aus dem Buch vermissen. Nicht nur die bereits erwähnten Windmühlen. Das Image prägen vor allem die großen Namen der Modebranche. Je leerer der Laden, desto bekannter die Marke – Völkerwanderungen wie vor hundert Jahren gibt es hier nicht mehr. Auch der Luna-Park musste schließen. Die Nazis haben dem Ruf des Boulevards den Garaus gemacht. Zu dekadent das Gehabe.
Dass hier es hier nicht nur „Hoch die Tassen“ hieß, beweisen die zahlreichen historischen Marksteine auf und um den Ku’damm herum. Stolpersteine zeugen von einer stolzen Zeit, die allzu abrupt endete. Eine Gedenktafel erinnert an das feige Attentat auf Rudi Dutschke. Das Büro des Sozialistischen Studentenbundes befand sich auf dem Ku’damm.
Der Mythos Kurfürstendamm ist ein wenig verblasst. Noch immer zieht es – verdientermaßen – viele hier hin. Doch der Nimbus der unbesiegbaren Partymeile ist futsch. Selbst das renommierte Theater musste dem Spekulantentum weichen. Doch die Geschichte wird immer in Erinnerung bleiben. Auch dank dieses Buches.