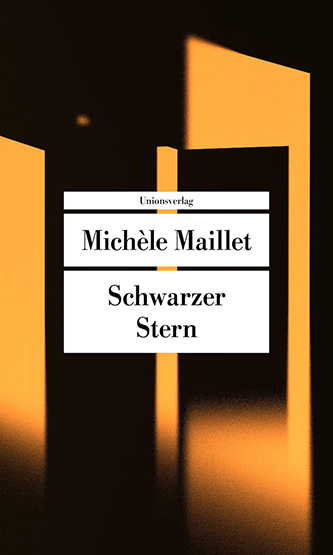Da hat man doch im Laufe der Pandemie fast den Blick für die wahren Sehnsüchte verloren. Alle wollen nur noch ihre Freiheit wieder. Wie das aussieht, kann kaum einer richtig in Worte fassen. Der Strandkorb an der Ostsee ist das Nonplusultra. Und dann kommt Charlotte Ueckert mit ihren Reiseerinnerungen um die Ecke und gibt die wahre Sehnsucht dem Leser und wahrhaft reiselustigen Freiheitssuchenden das zurück, was fast vergessen schien. Südsee. Die See und dann auch noch der Süden. Mehr Sehnsucht geht nicht!
Charlotte Ueckert wusste nur das über die Südsee, was man ohne viel Anstrengung als Allgemeinwissen bezeichnet. Cook, Robinson Crusoe, Thor Heyerdahl, die Bounty, endlose Strände und die Gemälde von Gauguin, Emil Nolde und Max Pechstein. Doch das ist es, was die Sehnsucht befeuert. Ist das Licht wirklich so wie bei den Malern der Moderne? Ist der Entdeckerlust inzwischen ein globalisierter Riegel vorgeschoben worden? Schmeckt das Meer hier anders?
Unerschrocken nähert sie sich den Atollen, die nach den Eroberern den Künstlern überlassen wurden. Gauguin war nach Cook und Bougainville ein Vertreter der neuen Sehnsuchtschürer. Seine Bilder wurden ob ihrer Obszönität vom Fachpublikum abgelehnt, dennoch ständig begafft. Diese Ungezwungenheit und Offenheit waren die Triebfeder für eigene Träume.
Charlotte Ueckert erlebt wie zwei Staaten, die eigentlich zusammengehören – West Samoa und Amerikanisch Samoa – so unterschiedlich sein können. Sie erkundet mit ihrer Herbergsmutter deren weitläufiges Grundstück. Die angelesenen Biographien reichert sie vor Ort mit persönlichen Eindrücken an, so dass die ursprüngliche Neugier Platz für Neues machen muss.
Beim Lesen hört man das Rauschen der Wellen, spürt wie sie sanft gegen den Strand schlagen ohne dabei bedrohlich zu wirken. Wohlwollend nimmt man zur Kenntnis, dass glücksbehaftete Wunscherfüllung an entlegenen ort auch ohne die kitschig erzeugten Bilder von sich sanft im Wind wiegenden Palmen auskommen.
Charlotte Ueckert reist mit dem Schiff von Insel zu Insel. Sie vermeidet sich über die strengen Zeitrahmen an Bord – gegessen wird pünktlich, aber vielleicht war das Schiff auch zu klein, um die gesamte Passagierliste in Schichten essen lassen zu müssen – den letzten Nerv rauben zu lassen. Ihr ging es ganz allein darum sich den Traum von der Südsee zu erfüllen. Und das auch gleich zweimal. Bei ihrer zweiten Reise sind ihre Gedanken intensiver. Sie muss nicht auf Teufel komm raus ihre Gedanken niederschreiben und postwendend den üblichen Erinnerungstinnef an sich reißen. Beim zweiten Mal ist die Autorin abgeklärter, doch nicht minder neugierig und beseelt davon ihren Traum noch eindrücklicher nachwirken zu lassen.