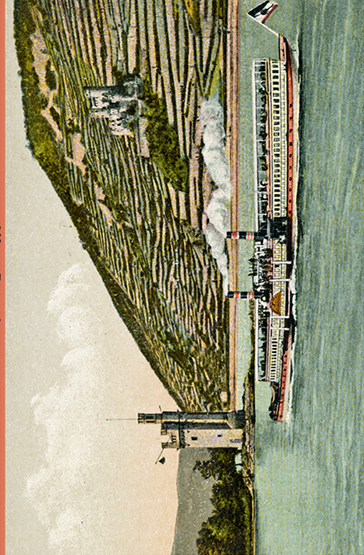Während auf der einen Seite des Atlantiks die Donnerwolken alles in Schutt und Asche legen, liegen am Tamarack Lake die Genesenden auf Liegestühlen und sollen sich jedweder Anstrengung durch Wegducken entziehen. Leo Marburg ist gerade angekommen. Mitte zwanzig, voller Energie. Dennoch macht ihm die Schwester bestimmt klar wie der Hase hier läuft. Ruhe. Und das in jeder Hinsicht. Keine Bewegung, keine Aufregung, keine Regung. Wenn sich der Patient an die Regeln hält, sie verinnerlicht hat, dann werden die Regeln ein wenig gelockert. Aber nur, wenn der Krankheitsverlauf es auch zulässt. Mit Tuberkulose ist nicht zu spaßen. Schon gar nicht in der Mitte des zweiten Jahrzehnts des vergangenen Jahrhunderts.
Miles Fairchild wird diese sedierte Runde in Unruhe versetzen. Sein Vorschlag man könne sich geistig gegenseitig herausfordern, sich unterhalten, sich sogar bilden, stößt auf ein geteiltes Echo. Die Schwesternschaft samt Arztpersonal sieht dem Vorhaben mit gemischten Gefühlen entgegen. Solange die Tuberkulose-Bakterien brav eingepackt im Körper keinen Schaden anrichten – wie aber will man das vorbeugend überprüfen? – ist alles in Ordnung. Wenn aber die Bakterien sich freisetzen und weitervermehren, dann beginnt die ganze Prozedur wieder von vorn. Wer will das schon? Vor allem, wenn man bedenkt, dass eine solche Kur nicht in ein paar Wochen zum gewünschten Resultat führt.
Auf der Patientenseite wird jede Abwechslung mit Beifallsstürmen begrüßt. Allerdings fallen die Vorträge sehr unterschiedlich aus. Gähnende Langeweile bei einem nicht enden wollenden Vortrag über Beton, lässt die Zuhörer am Gelingen des Vorhaben zweifeln. Doch nach und nach kommt Schwung in die Runde. Jeder der Anwesenden, geistreich, wohlsituiert, teils wohlhabend – in reichlich einem Jahrzehnt würden sie sich sicher bei eine Gatsby’schen Amüsement ein Stelldichein geben – hält Rückschau. So entsteht eine Spielwiese, die für jeden etwas parat hält: Naturwissenschaftler erfreuen sich an den Anekdoten über Marie Curie und Albert Einstein. Historiker staunen über die detaillierten Schilderungen der Zeit des Ersten Weltkrieges in einem Land, das von Erschütterungen weitgehend verschont blieb. Andrea Barrett raubt dem Leser die Luft und gibt sie ihren Protagonisten, damit sie atmen können.