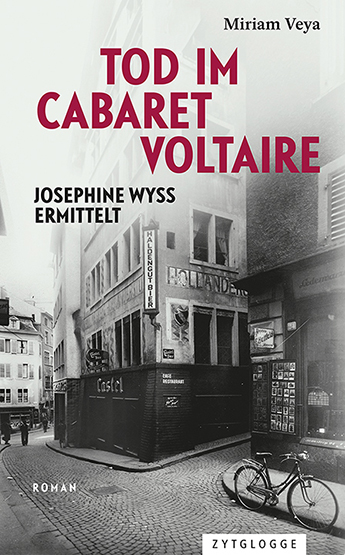Die Havel ist wohl der lebendigste Fluss, den es gibt. Es ist eine sanfte Geburt im Herzen Mecklenburgs. Dann schlängelt sich der Fluss wie ein lebhaftes Kind durch die Landschaft. Immer wieder stoppt es, bleibt stehen, schaut sich neugierig um. Dann staut es sich. Kleine Seen sind kaum noch als Havelfluss erkennbar. Dann wird es etwas stürmischer, die Havel kommt in die Pubertät. Steuert unvermeidlich auf die Partyhochburg Berlin zu. Tanzt und tobt sich aus. Doch niemals über die Stränge schlagend. Bis ihr irgendwann alles mal zu viel wird und sie trotzig gen Westen abdreht um dann gedankenverloren in der Elbe aufzugehen. Das nennt man dann wohl Lebenslauf…
Auf den 325 Kilometer Lebensweg erlebt man das, was manche nicht in tausend Jahren erleben werden. Niemals darf man außeracht lassen, dass dieser Fluss vielen bekannt ist. Das bedeutet, so ganz allein hat man besonders in den Sonnenmonaten niemals. Aber das bedeutet auch, dass Reisebücher wie dieses – immer auch schon die vierte Auflage – immer mehr an Bedeutung gewinnen. Denn nichts ist schlimmer als den wohl verdienten Urlaub mit anderen genießen zu müssen, die unter Erholung und Genuss etwas anderes verstehen als man selbst. Hat man Sinnesgenossen getroffen, ist es ein Leichtes bei der gemeinsamen Lektüre dieses Buches den nächsten Tage, den nächsten Trip auszukundschaften.
Dreihundert Seiten – also cirka eine Seite pro Kilometer Flusslauf – sind ausreichend, um der Havel die gebührende Ehre entgegenzubringen. Avus, Wannsee, Pfaueninsel – drei Namen, dreimal Sehnsuchtsorte. Unbestritten. Doch selbst in ihrer nächsten Umgebung gibt es Orte, die man suchen muss, die sich aber auch gern finden lassen. Wie der Friedhof der Namenlosen. Hier liegen Leute, deren Ende sich jäh vollzog, um die aber niemand trauern kann, weil sie keinen Namen tragen.
Die alte Industriestadt Brandenburg wird sicher jeden, der sie noch nie oder zum letzten Mal vor Jahren besuchte, in Erstaunen versetzen. Die rauchenden Schlote sind Vergangenheit. Heute regiert das Grün, liebliche Straßenzüge, romantische Uferpromenaden sind die Zierde dieser Stadt, die vor dreißig Jahren noch in einen Rauchkokon getaucht war. Der weitere Verlauf gen Westen wird wieder von einer unendlichen Weite geprägt. Obstwiesen, ertragreiche Felder, endlose Alleen und dicht bewachsene Ufer – das ist es, was man zu sehen bekommt, auch wenn man nicht direkt danach sucht.
Mit diesem Havel-Reiseband wird eine Kulturlandschaft erlebbar, die noch immer entdeckt werden kann. Man muss nicht mal so tief suchen. Eigentlich muss man nur in diesem Buch blättern…