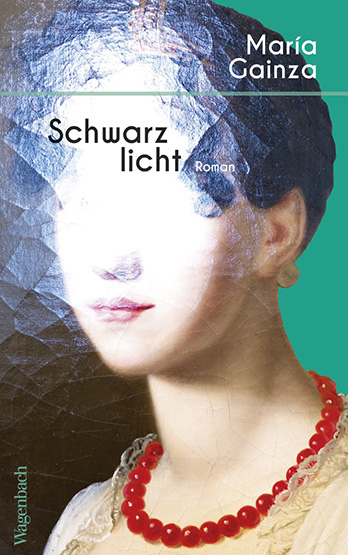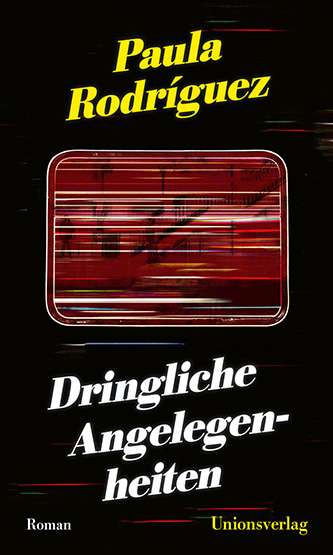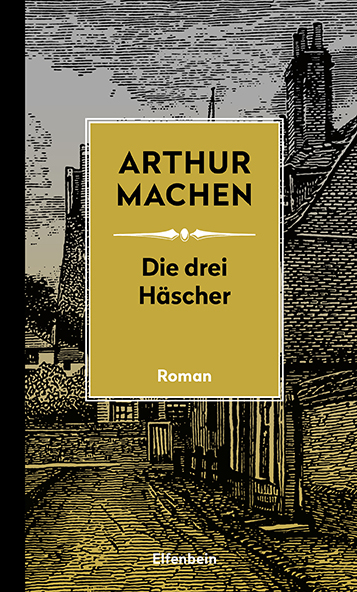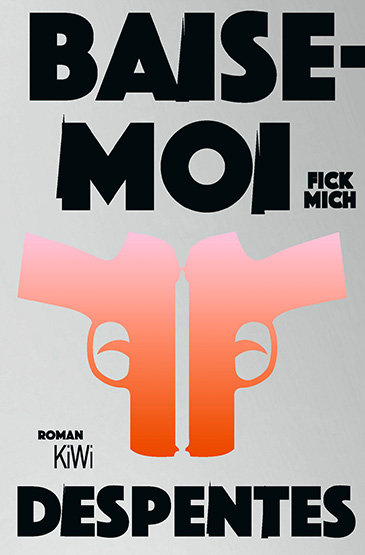Das Leben von Künstlern ist oft bemerkenswerter als ihre Werke. Und dabei ist es einerlei, ob sie nun erfolgreich waren oder am sprichwörtlichen Hungertuch nagten. Vincent van Gogh verbindet man in erster Linie mit seinem Ohr, das er sich abgeschnitten hat. Dann kommen seine Werke … gefolgt von seinem kargen Leben. Das Interesse an Kunst und Künstlern zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten.
María ist so eine, die sich für Kunst und ihre Erschaffer interessiert. Bei Enriqueta Macedo geht sie in die „Schule“ – sie ist die unumstrittene Kennerin der Szene. Sie weiß, was gut ist. Das betrifft die Kunst, aber auch sie selbst und die sie umgebenden Menschen. Schroff und direkt – das weiß sie, damit eckt sie an. Doch María ist das gerade recht. Sie lernt viel von Enriqueta. Auch wie man Kunst von Fälschung unterscheidet. Und dass auch Fälschungen Kunst sind. Oder es zumindest sein können.
Durch Enriqueta lernt sie eine illustre Runde kennen. Allesamt Fälscher, Gauner, Schieber, Künstler.
Als Enriqueta stirbt, ist es an María ihr Erbe fortzuführen. Doch es geht dabei nicht darum Künstler in den Himmel zu loben oder ihnen die Höllenfahrt vorzubereiten. Sie will in die Szene tiefer eintauchen als es jemals jemand zuvor tat. Sie weiß, dass Enriqueta jahrelang Fälschungen zu Originalen erklärt hat. Warum? Spaß an der Freude, Zurechtrücken der Verhältnisse, Geld? Letzteres wohl kaum, kommt María in den Sinn als sie die Wohnung ihrer ehemaligen Gönnerin sieht.
Der Kreis der Fälscher, die sich regelmäßig im Hotel Meláncolico – welch passender Name – trifft, fördert eine weitere Person hervor, die María unbedingt kennenlernen muss. La Negra. Eine Künstlerin/Fälscherin ohne Gesicht, ohne Vita, ohne Vermächtnis. Für María der Beginn einer Jagd, de im Dunklen beginnt, und mit deren Erhellung nichts als Nacht ans Tageslicht tritt…
María Gainza macht aus der Jagd nach der Unbekannten eine Reise in die Zwischenwelt. Hier existieren Schwarz und Weiß lediglich als Kontrast, deren Mischung ein waberndes Grau ergibt, das keinerlei Zugeständnisse macht. Als Leser taucht man in die Kunstwelt ein, wie wenn man an der Hand geführt zum ersten Mal ein Museum betritt. Alles neu, alles leuchtet, aber zugleich schaut man auch neugierig in die dunklen Ecken und sieht dort meist mehr als das, was einem so glanzvoll vorgesetzt wird.