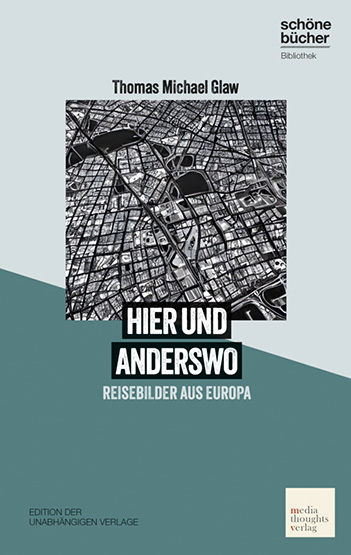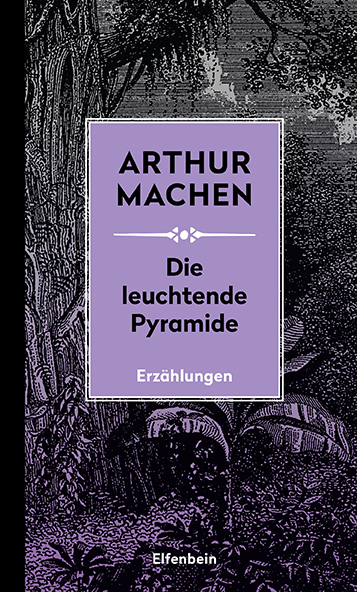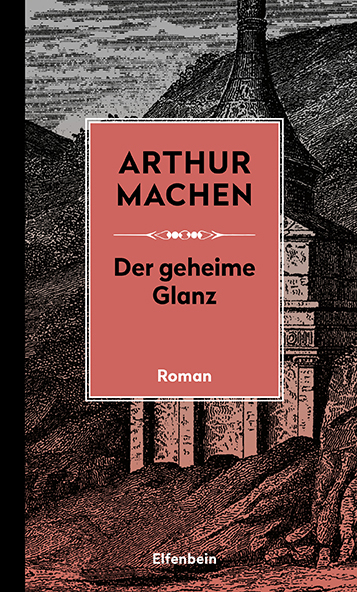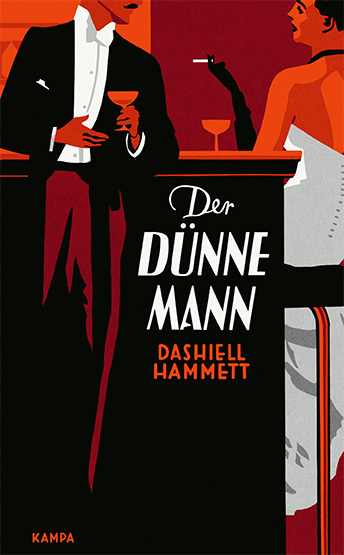Man spürt es ab der ersten Seite, ach was, aber der ersten Zeile: Thomas Michael Glaw reist gern. Und oft. Und er kann viel erzählen. Nicht über das, was man sehen muss, was jedem früher oder später vor die Augen kommt, sondern über das, was man suchen muss und finden kann. Und vor allem über das, was zu beachten ist. Reiseimpressionen mit Lerneffekt. Doch so statisch sollte man dieses kleine Büchlein nicht angehen. Es ist eine Art Hilfestellung für Reisenovizen wie alte Hasen, die über diejenigen lachen, die Catania in Spanien oder Griechenland verorten (die gibt es wirklich! Und das nicht zu knapp!).
Hier sind sie also die gesammelten Impressionen (Auszüge davon) eines Reiselebens. Von München nach Wien im Flieger? Niemals. Im Zug reist man entspannter, und auch nicht viel länger, wenn man die Eincheckzeiten und die Fahrten zum und vom Flughafen einberechnet. Und mit der ÖBB sogar pünktlich, freundlicher … einfach entspannter. Reisen als Sinnesrausch im positiven Sinn. Denn auch eine Zugverspätung kann eine Reise in einen Rausch verwandeln – Stichwort Blutrausch.
Wiens erster Bezirk hat für ihn den Rausch der Vergangenheit gegen die Tristesse des Übers eingetauscht. Übervolle Straßen, übermäßig viele Verkäufer, die überteuerte Tickets verkaufen, überall nur Touristen, die überhaupt kein echtes Wien mehr ans Tageslicht kommen lassen. Dennoch sind Wien und seine Cafés immer noch berauschend. Es sind halt nur andere Cafés, wo man sich zur morgendlichen Stunde Gazetten und Braunen einverleiben mögen möchte.
Südspanien im Winter ist ein feuchtes Vergnügen. Manchmal auch ein feuchtfröhliches, wenn man der Sprache nicht mächtig ist und aus Versehen etwas bestellt, was einen übermäßig beansprucht.
Roma als Amor zu verstehen, fällt leicht, wenn man die Ewige Stadt einmal besucht hat. Oder mehrmals. Die Stadt für sich allein hat man niemals. Es sei denn, man besucht einen Friedhof. Doch auch da ist Achtsamkeit angeraten. Furbo und Pignolo können einem manchmal ordentlich auf die Nerven gehen oder gar die letzten Reste davon rauben. Der Eine mogelt sich durch (und kommt damit auch immer durch), der Andere ist ein Pedant, den man so in Italien gar nicht vermutet. Eine köstliche Charakterstudie des Autors.
„Hier und anderswo“ ist ein kurzweiliges Lesevergnügen für alle, die Bestätigung suchen und/oder vor der Entscheidung stehen in alle Himmelsrichtungen zu flüchten. Knigge-Fallen lauern überall (da ist es wieder, dieses „über“), nicht hineinzutappen, ist die Kunst. In diesem Büchlein die Fallen zu erkennen, sie umschiffen zu können, ist keine Kunst, es ist fast schon eine Pflicht.