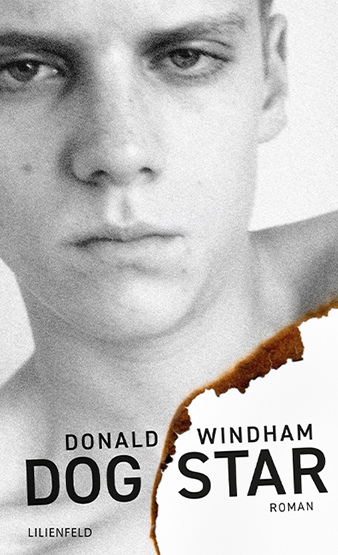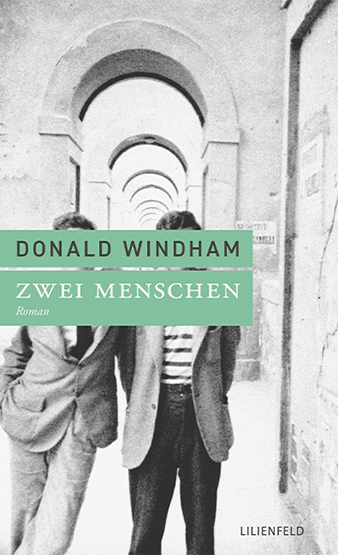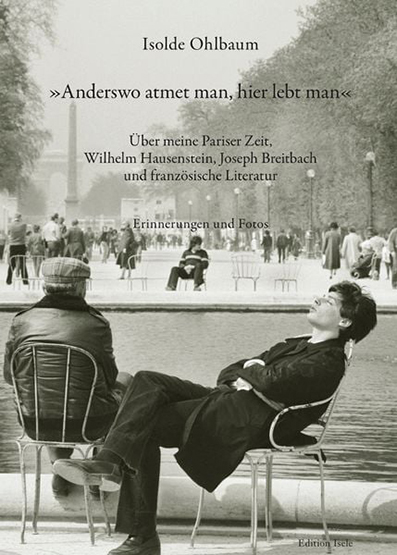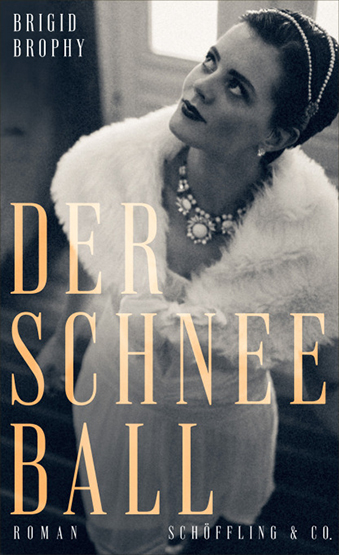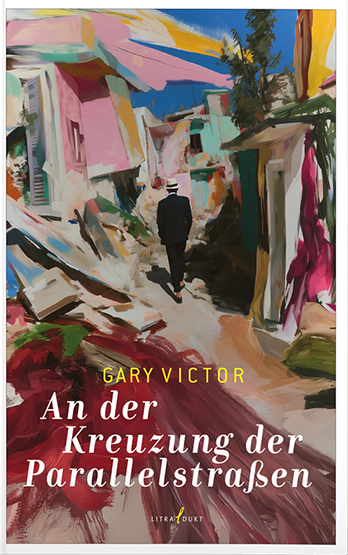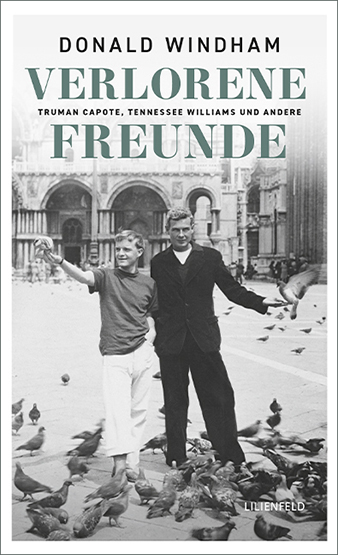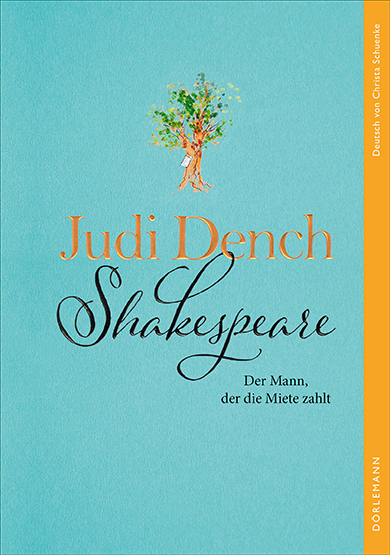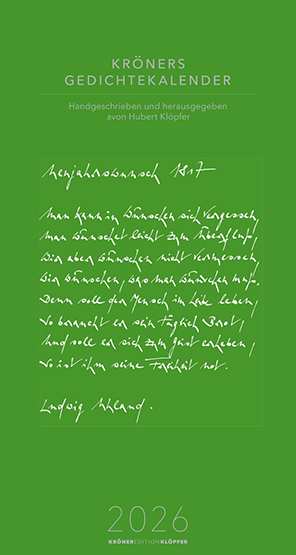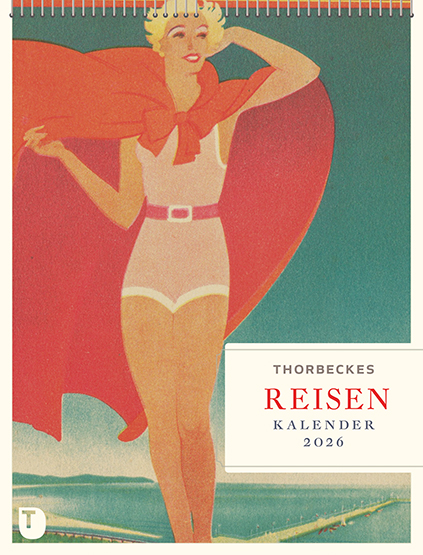Blackie ist weg und mal wieder da. Weg aus der Besserungsanstalt. In der war er, weil … ja, das ist erstmal unerheblich. Jedenfalls ist er weg. Einfach so. Schnappt sich seine Gitarre und läuft los. Immer der Sonne entgegen. Was so poetisch klingt, ist einfach nur eine Wegbeschreibung. Er springt auf einen LKW. Lässt sich treiben. Um der Poesie dieses „sich die Freiheit um die Nase wehen zu lassen“ noch mehr die Intensität zu klauen, lässt Donald Windham die zärtlichen Versuche mit der Gitarre ein wenig Romantik aufkommen zu lassen im Ruckeln des LKWs ersticken.
Blackie will heim. Heim bedeutet für ihn allerdings nur dorthin zu gehen, wo seine Mutter wohnt. Die ist sichtlich überrascht ihn zu sehen. Fragt aber auch nicht weiter nach, was ihn wieder zurücktreibt. Die Besserungsanstalt anzurufen, um den Verlust der Einrichtung als Bereicherung ihres eigenen Lebens zu erklären, kommt ihr aber nicht in den Sinn. Blackie ist halt wieder da. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Whitey ist der Grund warum Blackie ausgebüchst ist. Whitey, der Junge, der allen Respekt einflößte. Groß, stark, durchsetzungsfähig. Das hat Blackie imponiert. Doch Whitey – wer’s immer noch nicht kapiert hat: Gegensätze ziehen sich an. In diesem Fall in jeder Hinsicht – war mehr als nur ein Leidensgenosse in der Besserungsanstalt.
Und nun ist Blackie zurück. Heimatliche Gefühle kommen gar nicht erst auf. Alles um ihn herum scheint in Gleichgültigkeit zu versinken. Empathie, Zuneigung oder gar Liebe ist vollkommen aus dieser trostlosen Gegend verbannt. Kindheitserinnerungen als ausgelassene Spiele draußen – drinnen gab’s ja nichts, an dem man sich erfreuen konnte! – sind blasse Reflexionen einer Zeit, die es nie zu geben schien. Blackie ist wie ein Gast ohne Attribute. Willkommen oder nicht willkommen spielt keine Rolle. Er ist da. Und damit muss es auch reichen. Wer ihm Liebe entgegenbringt, wird von ihm mit Gefühlskälte zurückgegrüßt. Blackie will nur eines: Ein Leben führen. So mit Job und so. Mit Haus und so. Mit Anhang? Naja, vielleicht.
Donald Windham zeichnet ein Bild einer emotional verkümmerten Umgebung und Gesellschaft. Alle, was an Gefühlen zur Sprache kommt, ist kein Werben um Zuneigung, sondern um Anerkennung. Niemand schient in der Lage zu sein sich selbst zu erkennen. Es geht nur darum irgendwie irgendeinen Platz zu finden. Das Glück ist eine launige Diva. Das hat Blackie längst erkannt. Auch wenn er es sicher nicht so poetisch ausdrücken würde. Sein Funken Hoffnung ist die Tatsache, dass er sich noch nicht ganz aufgegeben hat. Er will vorankommen. Warum und wie, das ist ihm schleierhaft. Festgefahrene Strukturen geben ihm den Halt, der er nicht zu finden wagt. Das Buch erschien in einer Zeit, in der der „Fänger im Roggen“ die Literaturszene gehörig durchschüttelte. „Dog Star“ stößt nicht ins selbe Horn, sondern ist in seiner nur oberflächlichen emotionalen Verkümmertheit viel intensiver.