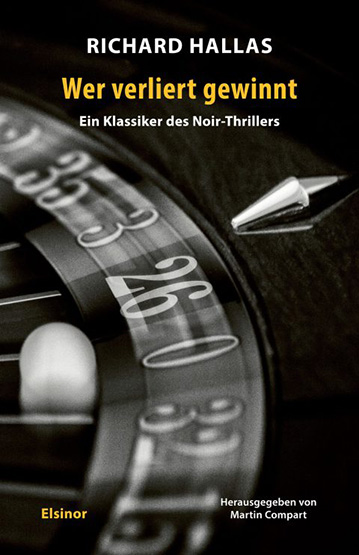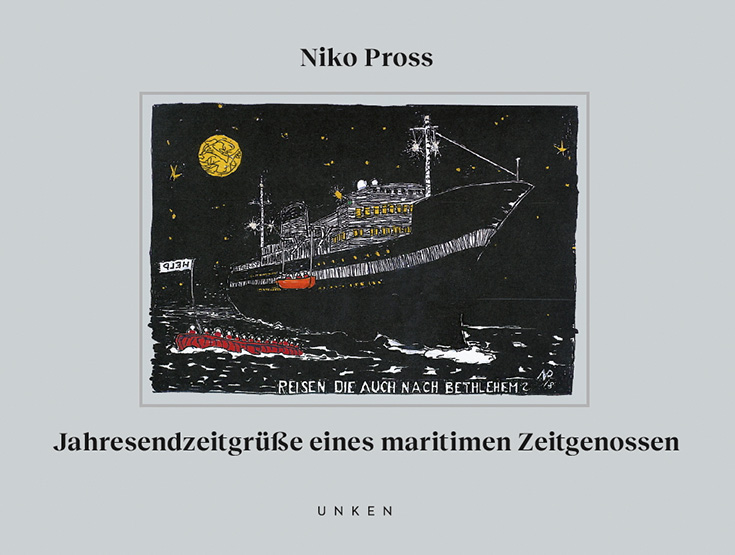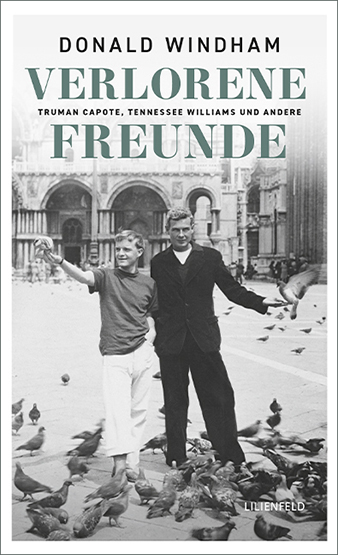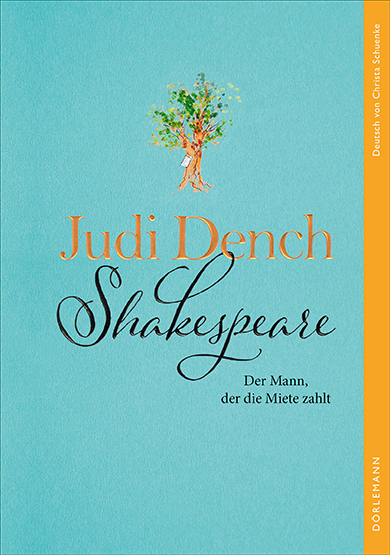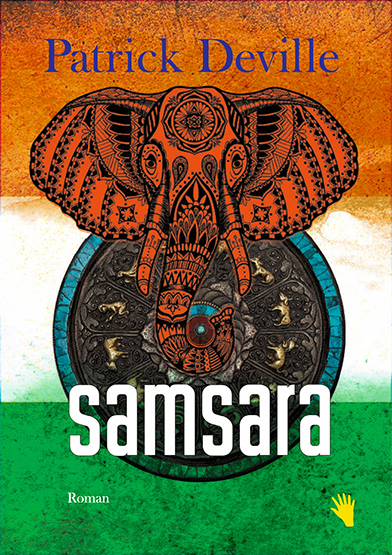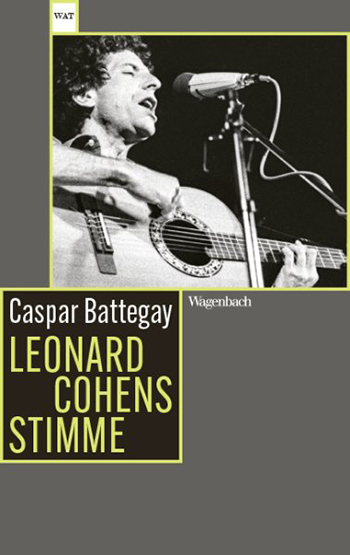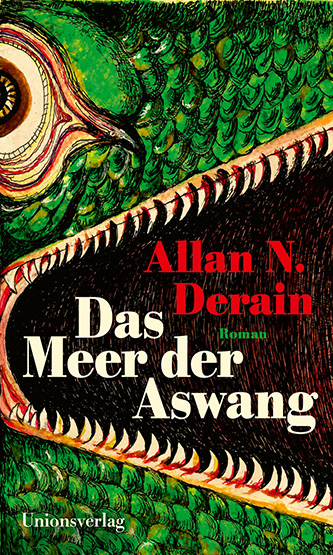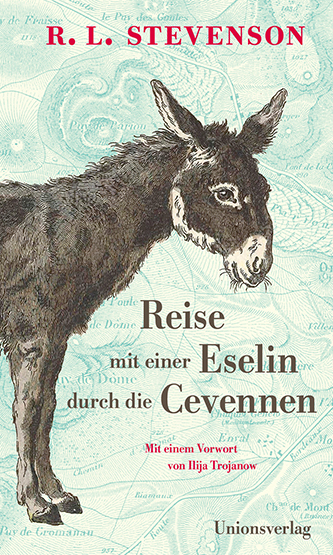Als Richard von der Arbeit an den Schmelzöfen nach Hause kommt, sieht schon von Weitem, dass im Diner, das er und seine Frau Lois besitzen kein Licht brennt. Ihm schwant Böses. Sicher liegt irgendwo ein Zettel. Es soll für eine sehr lange Zeit das letzte Mal sein, dass er recht behält. Sie, Lois, ist weg. Dickie, sein Sohn, auch. Ab nach Kalifornien, nach Hollywood. Sie ist verrückt danach.
Alte Fußballerweisheit: „Haste Sch… am Hacken, haste Sch… am Hacken“. Und jetzt beginnt eine ruhelose Reise. Von Oklahoma nach Kalifornien. Klar, Richard will Dickie wiedersehen. Ihn wiederhaben. Und Lois eventuell auch. Der Trip im Waggon, selbst Viecher reisen komfortabler, entwickelt sich zum Albtraum. Jeder mit ein paar Muskeln und weißer Hautfarbe – es ist die Zeit der Depression, Ende 30er Jahre des 20ten Jahrhunderts – malträtiert diejenigen, denen eines dieser Attribute fehlt. Am schlimmsten trifft es die, denen beides fehlt. Und unterwegs sorgen die staatlichen Organe dafür, dass nicht zu viel Platz im Wagen bleibt.
In Kalifornien trifft Richard auf so manches Pack. Zum Einen die Verwandte, die Lois aufgenommen hat(te). Ein hinterhältiges Biest, das die Polizei ruft. Richard ist wieder on the road. Ein Regisseur – juchhu, wir sind Kalifornien! – ist wohl der einzige, der Richard halbwegs so was wie den Glauben an Licht am Ende des ewig dunklen Tunnels geben könnte. Ein Ganove hat einen todsicheren Plan um an Geld zu kommen. Richard zögert, zweifelt, hat aber schon eine stattliche Anzahlung bekommen – es geht schief, was schief gehen kann. In den Zeitungen wird dann ebenso gelogen wie auf den Straßen betrogen wird. Selbst das zufällige Glück bei einer Frau unterzukommen, erweist sich alsbald als Trugbild. Und von Dickie keine Spur. Die Taschen leer. Desillusioniert streift Richard durch das Land, das so viel verheißt, jedoch in Wahrheit ein Sündenpfuhl voller Schlaglöcher ist, deren Grund man nicht sehen kann.
Immer wieder tappt man beim Lesen in die selbst gestellte Falle vermeintlich zu wissen, was auf den folgenden Seiten passiert. Und schon schnappt die Bärenfalle zu! Ströme schamhaften Blutes ergießen sich vor dem geistigen Auge. Wieder mal aufs falsche Pferd gesetzt. Genauso geht es Richard! Und der Typ mit der Kerze am Ende des Tunnels – der bekommt auch noch sein Fett ab!
Richard Hallas hat nur einen Noir geschrieben, auch wenn es diesen Begriff bei Erscheinen noch nicht gab bzw. er noch nicht anerkannt wurde. Und der war ein Erfolg. Dann verschollen, und nun in deutscher Übersetzung (aus dem Jahr 1944, in der Schweiz erschienen) endlich wieder zugängig. Anna Katharina Rehmann-Salten war für die Übersetzung verantwortlich. Und jetzt kommt der eigentliche Knüller: Sie, die Übersetzerin verwaltete den Nachlass vom Schöpfer von „Bambi“. Er, Richard Hallas, eigentlich Eric Knight, ist der Schöpfer von „Lassie“. Und dann so was Düsteres, Dunkles, Hoffnungsloses?! Man setzt oft auf Schwarz, und dann kommt Rot. Wer sagt eigentlich, dass das schlecht sein muss?