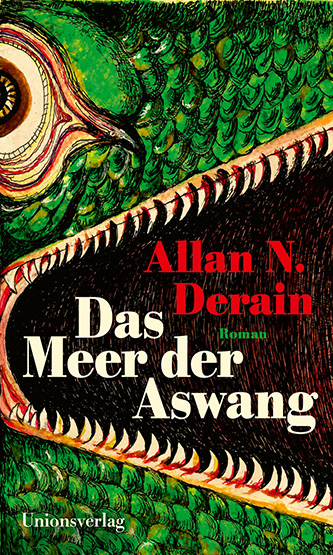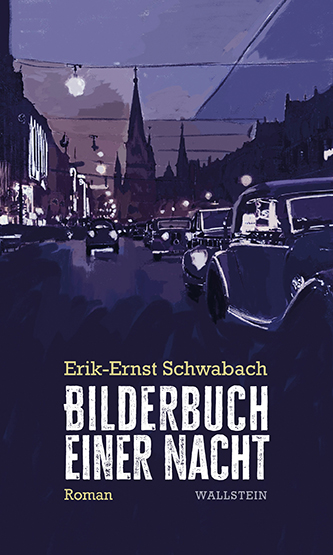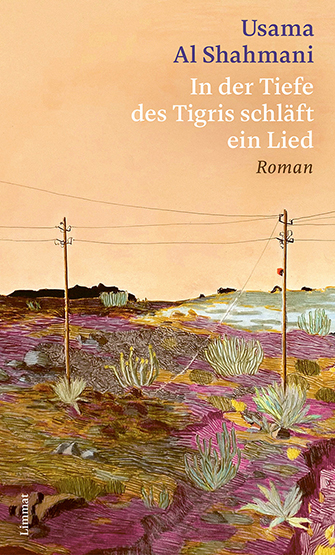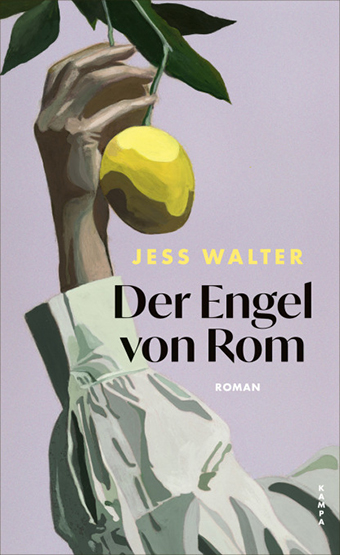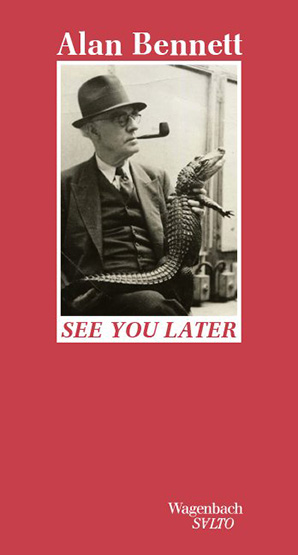Der Titel verspricht unendliche Weiten. Ja, das Buch hält dieses Versprechen. Unendlich aber als Synonym für Unentdecktes. Wer kennt schon die Bedeutung einer Aswang in der philippinischen Kultur?! Wer weiß über was eine Aswang ist?! Nun, Aswang ist – das verrät schon der Artikel – ein weibliches Wesen.
Luklak ist ein Mädchen, das schon länger gewisse Veränderungen an sich wahrnimmt. Sie kennt die Legenden von Aswang, Wesen, die in jeder Hinsicht frei sind. Sie kennen keine Lebensregeln, ihr Tun und Denken ist von wirklicher Freiheit geprägt. Das allein schon regt zum Nachdenken an. Denn Freiheit ist in heutiger Zeit ein dehnbarer und immer zum eigenen Vorteil verdrehter Begriff. Meist ist es nur das Unvermögen und die Weigerung einzelne, allgemeingültige Normen anzuerkennen, weil man dafür einen Schritt zu viel machen muss. Bequemlichkeit wäre in diesen Fällen wohl angebracht.
Aswang sind freie Wesen. Dennoch in einem Korsett aus eigener Mystik gefangen. Sie können jede Form annehmen, die sie wollen. Je nachdem womit sie in Berührung gekommen sind. Die Wandlung zur Aswang ist also nicht ganz freiwillig, weil – und das ist das Paradoxe – sie schon immer Aswang waren. Das steht gleich zu Beginn des Buches so geschrieben. Auch hier muss man erstmal seine westlich geformten Gedanken sortieren, … sie freilassen.
Und das wird sich bis zum Ende des Buches nicht ändern. Zum Einen liegt das an den doch für unsere Ohren fremden Begriffe. An die gewöhnt man sich jedoch schnell, lässt man sich vom Lesefluss mitreißen. Andererseits ist der Fortgang der Wandlung nun nicht eben die Art von Geschichte, der man oft begegnet. Es ist mystisch, fremd, anders. Aber, und dieses Aber kann man gar nicht groß genug schreiben: Diese mystische, fremde, andere Welt ist so spannend, dass man gern noch einmal ein paar Seiten zurückblättert, um sich noch einmal zu vergewissern, alles richtig verstanden zu haben. Zum Inhalt darf an dieser Stelle eigentlich gar nichts gesagt werden. Jeder muss selbst zum Forscher werden und sich in die Welt der Aswang, der Familie von Luklak, den Philippinen einlesen. Fasziniert taucht man dank der sanften Worte von Allan N. Derain in eine Welt ein, die noch nie so eindrucksvoll beschrieben wurde. Filmfans ist die Figur der Aswang in einschlägigen Filmen vielleicht schon mal vor Augen gekommen. Doch ihre Darstellung als düstere, mordlüsterne Wesen entspricht nicht der kompletten Wahrheit. „Das Meer der Aswang“ hingegen ist ein wahres Füllhorn an neuen Einsichten in eine Kultur, die ab sofort gar nicht mehr so fremd ist.