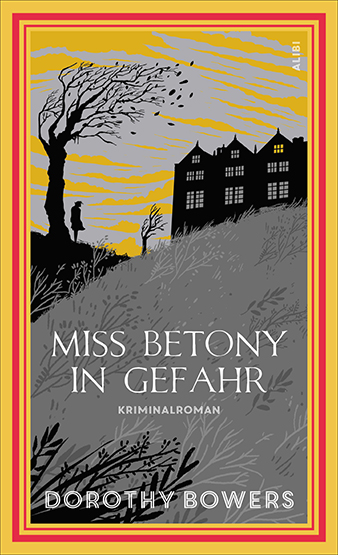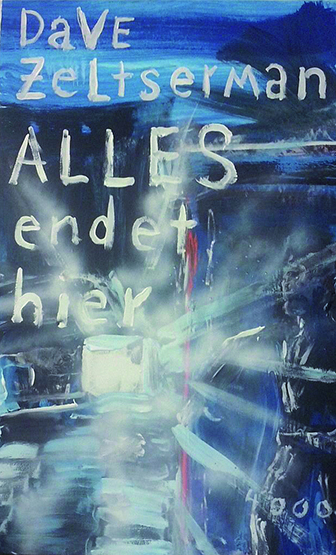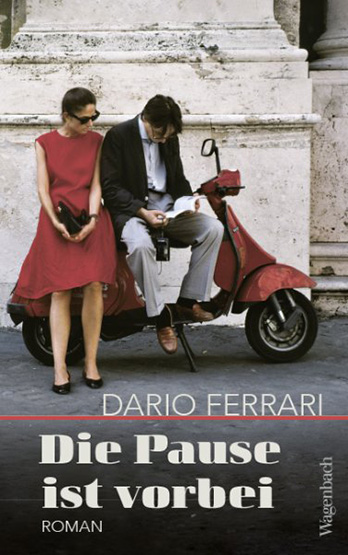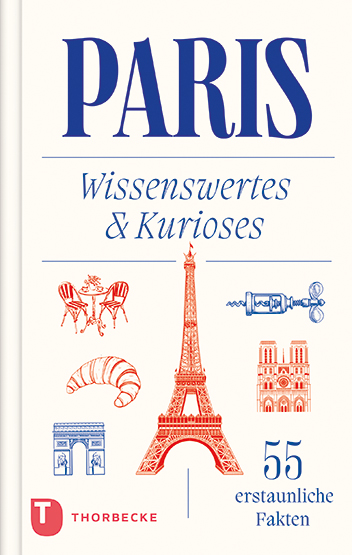„ I would do anything for love but I won’t do that“ – so kryptisch Meat Loafs Welthit so manchem vorgekommen sein muss, so klar liegt dre Fall in diesem Buch. Doug Guthrie, eine ehemaliger Säufer, der sich mittlerweile zu gewieften Geschäftsmann gemausert hat, ist als Professor Romance bekannt. Seine Kolumne wird fiebrig gelesen. Denn er gibt „hoffnungslosen Fällen“ Hoffnung in Sachen Beziehungen. Beziehungsweise (!) wie man den ersten Schritt tut. Und er verweist – wenig subtil – auf seine Ratgeber, die als Buch für nur 200$ pro Buch käuflich zu erwerben sind. Das Prinzip funktioniert und füllt das Konto des knapp über 60jährigen ordentlich. Mehr aber auch nicht. Denn die einzige Frau in seinem Leben ist seine Mutter, und die ist auch nur körperlich anwesend.
Das schreiberische „Genie“ hinter Professor Romance ist jedoch Lance Bertovich. Sein Ghostwriter. Schriftsteller mit dem scheinbar perfekten Leben. Sein Einkommen ist dank wasserfestem Vertrag als Schreiber für Professor Romance und üppigen Prämien stabil. Seine Frau liebt und achtet ihn, sein Sohn ist ein Schatz.
Zu den Kunden – mehr sind sie nicht, die verzweifelten Seelen – zählt auch Norman Bright. Ein unauffälliger Angestellter in einer Biomedizinischen Firma. Mittzwanziger, ganz gut aussehend mit enormen Selbstzweifeln. Seine Kollegin Cynthia Collingsworth hat es ihm angetan. Ihr Gang, ihre Erscheinung, ihr Wesen – all das und noch viel mehr tragen dazu bei, dass Norman sich einfach nicht traut sie anzusprechen und sie für sich zu gewinnen. Seine Mails an Professor Romance werden auch nicht beantwortet. In den Ratgeberbüchern – Norman kann sich die 600$ für Band I bis III locker leisten – sind schlussendlich auch keine endgültige Lösung.
Während Norman sich bis auf die Knochen blamiert bei dem Versuch mit Hilfe der Ratschläge von Professor Romance Cynthia auf sich aufmerksam zu machen, ohne dabei die Selbstachtung zu verlieren und Achtung in ihren Augen zu gewinnen, stürzt sich Lance Bertovich in eine Affäre. Und bringt so alle Stabilität in seinem Leben ins Wanken wie es kein kalifornisches Erdbeben je zu tun vermag. Und Doug? Der sucht was auch immer zwischen den Schenkeln von Prostituierten. Das muss Liebe sein.
Und dass das alles nur der Anfang einer gigantischen Höllenfahrt ist, wird dem Leser Seite für Seite klarer. Kompromisslos jagt Mark SaFranko Doug, Lance, Norman durch so ziemlich jeden Vorhof der Hölle. Erlösung – ob nun im Paradies oder der Hölle – exklusive. Man könnte sich nun entspannt zurücklehnen und diesen Roman mit einem gewissen, fast schon selbst gefälligen Grinsen genießen und in sich versunken kopfnickend in einem „ich hab’s kommen sehen“ einigeln. Doch dafür ist der Spannungsbogen schon zu sehr gespannt. Die Frage ist nur, wie weit geht der Autor, um der Sache Herr zu werden. Er geht weit. Weiter als man es sich vorstellen darf.