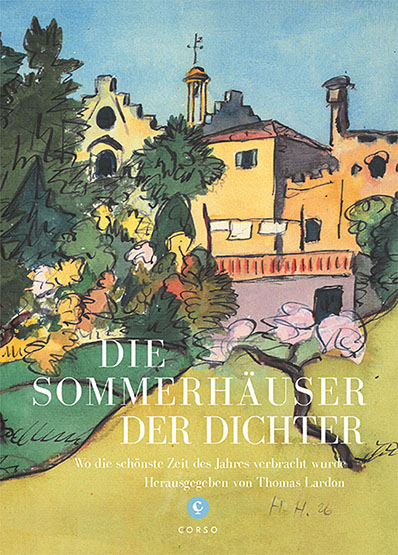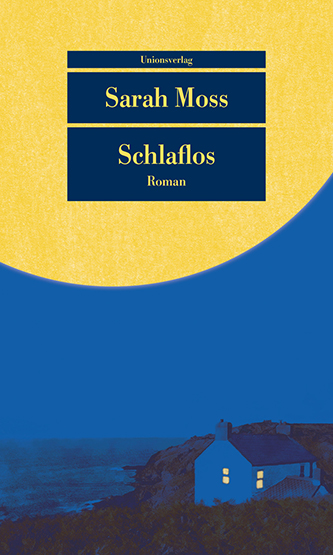Manchmal hängt ein Leben am seidenen Faden. Diese fast schon als poetisch einzustufende Phrase birgt jedoch mehr in sich als es sich die meisten vorstellen können. Manchmal aber auch hängt das Leben an einem papiernen Faden. Genauer gesagt am Papier, an den Papieren selbst. Wenn einer davon erzählen kann, dann ist es Moussa Mbarek. Und Yvonn Spauschus hat seine Geschichte aufgeschrieben.
Moussa Mbarek gehört zum Volk der Tuareg. Ihr Land, das nicht durch geographische Grenzen erkennbar ist, sondern Land ist, auf dem sie wandern, und das nicht im Sinne von pfeifend, mit dem Wanderstock, um ans Ziel zu gelangen! Sie haben ihre eigene Kultur, Sprache und Schrift. Doch in jedem Land (welches durch eine geographische Linie sich von anderen Ländern abgrenzt) werden sie argwöhnisch beäugt. Sie sind staatenlos. Sie sind nicht aus Mali, Niger, Libyen, Algerien oder Burkina Faso. Das ist nur solange ohne Belang bis sie sich ausweisen müssen, damit sie nicht ausgewiesen werden.
Ihm gelang es nach Deutschland zu kommen. Als Künstler wollte er arbeiten, sich ausdrücken und auch auf die Situation seines Volkes aufmerksam machen. Die erste Hälfte dieses besonderen Buches zieren diese Werke, die mit kurzen Texten die Ursprünge der Bilder erklären. Linolschnitte, Aquarelle und Drucktechniken sind die bevorzugten Techniken von Moussa Mbarek.
Es ist unerlässlich zu erwähnen, dass ein Künstlerleben oft mit Entbehrungen einhergeht. Das Klischee das daraus oft die eindrücklichsten Ergebnisse erzielt werden, mag das schlichte Gemüt entzücken, ist aber in keinster Weise eine zwingende Erforderlichkeit. Schon gar nicht Vertreibung aus dem angestammten Lebensraum, weil man nicht der ausgeschriebenen Norm entspricht. Wenn das so wäre, würde der Kunstmarkt unter der Wucht beispielsweise der afrikanischen Kunstflut zusammenbrechen.
Dieses kleine Büchlein ist einzig allein nur im Format vielleicht als klein zu bezeichnen. Im Inneren entblättert sich seine wahre Größe. Stilechte Kunst aus den Händen eines Tuareg, die bei längerem Verweilen immer wieder neue Sichtweisen aufzeigt. Kraftvolle Farben, die den Betrachter ins ferne Afrika ziehen, das durch eben diese Kunst so nahbar wird.
Die Texte von Yvonn Spauschus im zweiten Teil zeigen keineswegs nur Verzweiflung, sondern sind Mutmacher für all diejenigen, die den steinigen Weg der Flucht ebenso kennen.