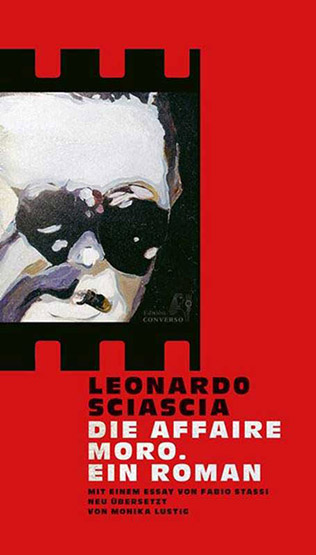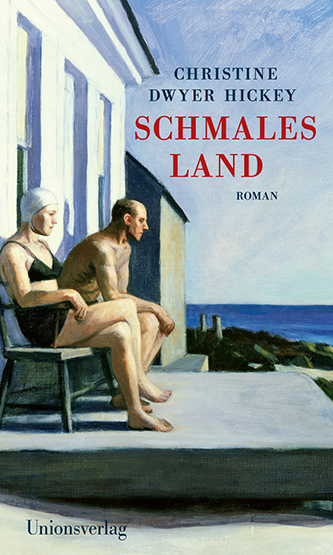Urlaubssouvenirs lukullischer Art sind immer noch die nachhaltigsten. Vino aus italia, fromage aus France oder exotische Gewürze aus aller Herren Länder. Und das ist nicht einmal eine Erfindung der Moderne. Schon Kolumbus reiste gen Westen, um nicht einfach nur einen neuen Weg zu entdecken. Er wollte Routen für Gewürzhändler erschließen. Gaumenfreuden waren schon immer ein guter Antrieb die Welt zu erkunden.
Michi Strausfeld geht es nicht anders. Ihre kulinarischen Erkundungen durch Mexico, Peru und Brasilien sind ein Abenteuer, das beim Zuschlagen des Buches noch lange nicht enden muss. Immer wieder werden die Ausführungen zu den Wurzeln – im wahrsten Sinne des Wortes – von Rezepten unterbrochen, die man leicht nachkochen kann, auch wenn die Suche nach den Zutaten ein wenig mehr Zeit in Anspruch nimmt als der Wocheneinkauf beim Discounter.
Immer wieder wird man daran erinnert, dass die ach so heimischen Produkte, die die eigene Kultur so einzigartig machen schlussendlich auch einen Migrationshintergrund haben. Denn Kartoffeln sind nicht auf deutschem Mist gewachsen! Im Gegenzug hielten unter anderem Olivenöl und Weizen in Lateinamerika Einzug. Es war, ist und wird immer ein Geben und Nehmen sein. Was aber nicht dazu führen sollte, dass Kartoffelpuffer nun als lateinamerikanisch gelten…
Vielmehr bereichern auch immer öfter hierzulande Huevos rancheros die gedeckten Tische. Wie man sie so originalgetreu wie möglich zubereitet … Rezept steht im Buch.
Die Fusion beider Welten tritt im Küchenbereich an mehr als nur einer Stelle zutage. Klosterbewohner aus der alten Welt mussten sich mit den Gegebenheiten ihrer eroberten Gebiete anfreunden. Und so entstanden Mole poblano con pollo, Hühnchen mit Schokoladensauce und Chili. Beim Dombau in Köln gab’s das garantiert nicht.
Die Küchen Mexicos, Perus und Brasiliens sind einzigartig. Mexicos Küche ist sogar Weltkulturerbe. Und Peru gilt mittlerweile als Schmelztiegel für eine neue Küche. So scharf die Gerichte manchmal anmuten, so feurig ist die Leidenschaft, mit der dieses rote Büchlein geschrieben wurde.
Wem schon beim lesen der Magen knurrt – und er wird knurren, versprochen – der hat sich die Erlaubnis erlesen das Buch beiseitezulegen und sich an den Herd zu stellen. Und mit einem Mal ist er in einem Koch-El-Dorado-Teufelskreis: Buch – Kochen – Buch – Kochen.