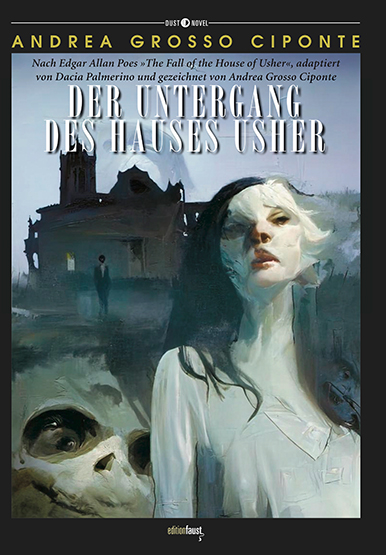Wie soll man in der Fremde Halt finden, wenn der Boden aus einem Gemisch auf Ablehnung gebaut ist? Ellis kennt die Antwort auf diese Frage nicht. Sie ist mit ihrer Mutter aus Italien nach Deutschland gekommen. Alles um sie herum ist fremd. Die Menschen, die Sprache, die Kultur. Vor allem aber diejenigen, die jede Minute um sie herum sind.
Das ändert sich als Grace in ihr Leben tritt. Auf Anhieb sind sich beide so nah wie es sonst nur Schwestern sein können. Von nun an gibt es sie nur noch im Doppelpack. Selbst Ellis’ Mutter bekommt die Tochter nur noch selten zu sehen. Niemals würden sie getrennt sein. Ellis weiß das und klammert sich daran fest wie ein Koala an einem Eukalyptusbaum.
Doch Grace verändert sich. Und wechselt – wie Ellis es sieht – die Seiten.
Jahre später kommen sich beide – nun schon – Frauen wieder näher. Sie verbringen eine Zeit in Italien. Bei Ellis’ Familie. Bei der Nonna. Vorsichtig rücken Ellis und Grace näher aneinander. Gehen gemeinsam die Umgebung erkunden, die für beide fremd ist. Ellis hat ihre Heimat nun in Deutschland. Und Grace kennt in dieser Gegend nichts und niemanden. Außer Ellis. Dennoch schaffen es beide nicht das, was damals geschah aufzuarbeiten. Warum wechselte Grace die Seiten? Die Frage wird in den Raum gestellt. Dort bleibt sie allerdings auch. Oder sind es gar die Worte, die nicht ausgesprochen werden, die die Verständigung so einfach machen?
Selene Mariani ist in Verona und Dresden aufgewachsen. Ihr Romandebüt weißt Spuren dieses Weges auf. Wohlwollend gibt sie beiden Frauen den Raum, den sie benötigen, um sich frei entfalten zu können. Dass das nicht immer schmerzfrei über die Bühne gehen kann, wird ihnen erst im Laufe der Zeit klar.
Mit behutsamen Worten, im rasanten Wechsel der Zeitebenen und unverwüstlichem Glauben daran, dass die beiden wieder zueinander finden werden, berauscht man sich am Festival der Gedanken zweier Frauen, die sich nur eines wünschen: Endlich wieder beisammen zu sein und die Geister der Vergangenheit in den azurblauen Himmel aufsteigen zu sehen.