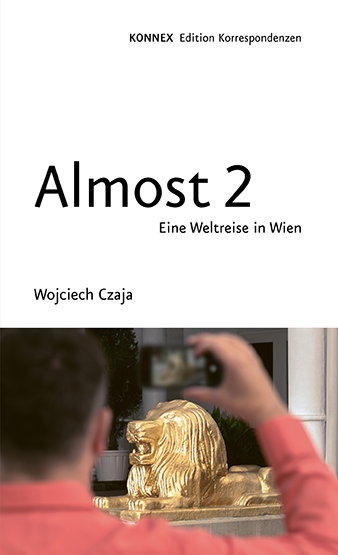Es gibt Tage, an denen wäre man lieber im Bett geblieben. Weil man Angst vor dem hat, was da kommt. Angst der Herausforderung nicht standzuhalten. Angst einen Weg zu beschreiten, der mehr als wackelig ist. Furo Wabiboko kann über solche Ängste nur lachen. Denn er hat ein echtes Problem. Heute steht ein wichtiges Vorstellungsgespräch auf dem Plan. Er hat sich gut vorbereitet, gut geschlafen. Doch als er aufwacht, ist nichts mehr wies es war. Er lebt in Lagos, dem Millionen-Moloch im Süden Nigerias, dem bevölkerungsreichsten Land Afrikas. Hier leben hunderte Völker, mehr schlecht als recht zusammen. Das Sprachenwirrwar ist nicht zu bändigen. Hier kann es sein, dass am anderen Ende der Stadt ein Dialekt gesprochen wird, den selbst engste Verwandte nicht verstehen.
Nicht verstehen kann Furo das, was des Nachts mit ihm passiert ist. Er ist weiß. Weiß. Weiße Hautfarbe. Dort, wo bisher das satteste Schwarz seinen Körper zierte. Weiß. Von nun auf gleich. Alles Weiß. Alles? Nein ein Teil seines Körpers wehrte sich gegen die Verweißung, sein Hinterteil ist immer noch schwarz! Das Bild muss man erstmal auf sich wirken lassen…
Furo ist also wach, und weiß. Und er weiß nicht wie er, der Weiße, seiner Familie, schwarz, nun verdeutlichen soll wie es dazu kam, der er über Nacht aus einer überreifen plantain (Kochbanane) zu einer weißen Bohne geworden ist. Wie bei Kafkas „Verwandlung“ muss er nun versuchen sich anzupassen, Ausreden zu erfinden, neue Wege zu beschreiten. Doch wie? Er hat ja nicht mal einen Kobo (kleinste nigerianische Münze, einen Bruchteil eines europäischen Cent) in der Tasche. Er muss in der Masse untertauchen, um nicht erkannt zu werden. Wie soll das gehen? In Lagos und Umkreis leben 30 oder noch mehr Millionen Menschen – 99,9 Prozent sind schwarz, das fällt ein Weißer unweigerlich auf. Ach ja, da ist ja noch die Sache mit dem Vorstellungsgespräch. Furo hat es heute Morgen wahrlich nicht leicht…
A. Igoni Barrett nimmt seinen Protagonisten an die Hand und leitet ihn durch diese ungewöhnlich Situation. Ein happy end ist erst einmal nicht in Sicht. Auch wenn Furo sich auf einmal vor Herausforderungen gestellt sieht, die bisher unüberwindbar waren. Nun – als Weißer – hat er Chancen, die den meisten für immer verwehrt bleiben. Furo ist jetzt Weiß. Privilegiert. Was Besseres? Öfter als zuvor.
Es ist anfangs ein köstlicher Spaß dieser absurden Geschichte zu folgen. Nach und nach gelingt der Umschwung zu einer ernsthaften Auseinandersetzung mit der nigerianischen Gesellschaft. Das kulturelle Erbe des Landes ist ein wild zusammen gewürfeltes Geflecht aus unzähligen Traditionen und Ritualen, das es unmöglich macht eine nationale Identität zu kreieren. Man ist Igbo oder Edo, Fulani oder Haussa, aber nur außerhalb der Gesellschaft ist man Nigerianer. Innerhalb ist es eigentlich nur die Hautfarbe, die zusammenschweißt. Wenn die sich ins Gegenteil verklärt, steht die ganze Welt Kopf. Und das, was einen einst getragen hat, wirkt blutleer.