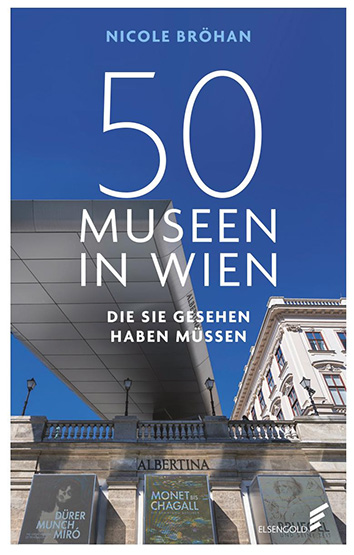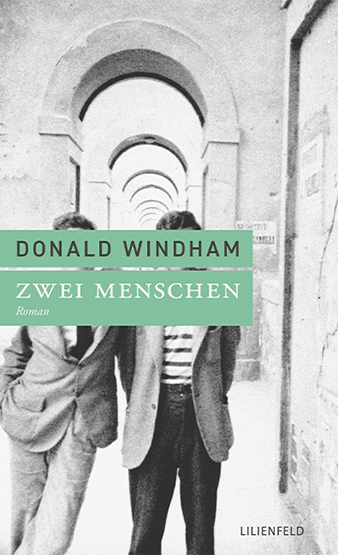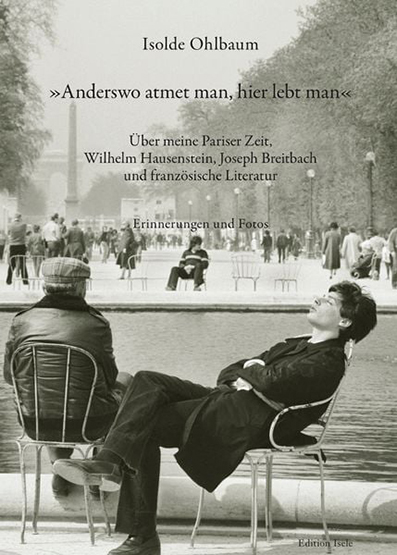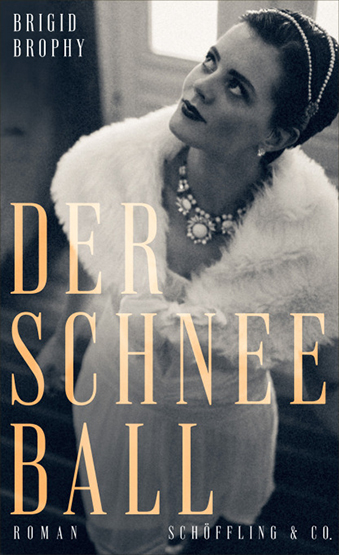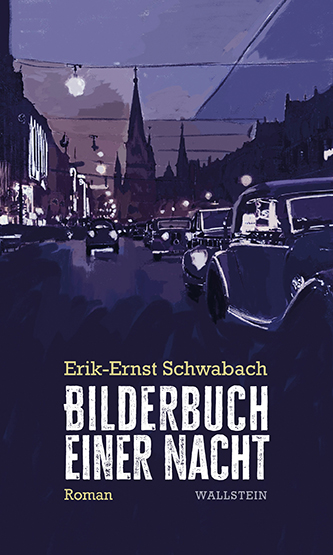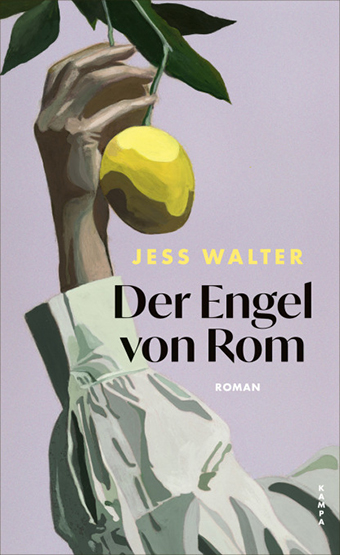Wien ohne Museumsbesuch ist möglich, aber … irgendwie auch wieder nicht. Die Stadt atmet an jeder Ecke royale Geschichte aus. Man kommt nicht umhin, doch mal die Nase in das eine oder andere Museum zu stecken. Man muss sie ja auch nicht suchen.
Allen voran die Albertina. Das Museum für alle, die vor allem vor Gemälden tief in sie eindringen können. Zentral gelegen, ist das Museum nicht nur Regenschutz an Schmuddeltagen, sondern und vor allem ein Augenschmaus für jedermann. Allein schon Monets Seerosen fesseln so manchen Durchgangsbesucher für etliche Minuten.
Gleich um die Ecke wird’s übersichtlicher – die Albertina kann auf einen Fundus im siebenstelligen Bereich zurückgreifen. Das Globusmuseum mag um einiges kleiner sein, doch die elegante Präsentation in den teils deckenhohen Vitrinen lässt Fernweh aufkommen. Und im Erdgeschoss ist die gesamte Welt versammelt. Denn befindet sich das Esperanto-Museum. Erstaunlich wie präsent die künstliche Weltsprache sich darstellen lässt.
Was wäre Wien ohne kaiserliche Pracht?! Nicht zu übersehen sind das Kunst- und das Naturhistorische Museum. Prachtbauten, die traditionelle Darstellung der Objekte im modernen Gewand vereinen. Beide gehören zu Wien wie Donau und Schnitzel.
Dieser Museumsband verbindet informativ und sehr gut handhabbar das Offensichtliche, Bekannte mit dem leicht versteckten. Wer weiß schon, dass Wiener Aktionismus und ein Kindermuseum (wo nun wirklich niemand meckert, wenn man Kunst anfasst) ebenso zum Stadtbild gehören wie Uhrenmuseum und Illusionen, die einen fast vergessen lassen, dass man sich in einem Museum befindet – sofern man dies möchte.
Wer Wien schon kennt, war garantiert schon in einem der zahlreichen Museen. Sie gehören einfach zu einem Wientrip dazu. Doch die kleinen, versteckten Kleinode machen diesen handlichen Band zu einem unverzichtbaren Begleiter. Und oft ist es erstaunlich nah bis zum nächsten Schauerlebnis. Die klare Gliederung und die kurzen ausreichenden Infos zur weiteren Recherche sind ein echter Anker auf dem voller Attraktionen steckenden Wiener Pflaster.
Vieles hat man vielleicht schon mal gehört, doch so recht weiß man dann doch nichts darüber. Die Texte im Buch sind Ratgeber, Appetitmacher und Wegweiser in Einem. Von Kaffee über Militärgeschichte bis zu Musik – auch hier gilt wieder: es geht nicht ohne! – ist alles dabei. Stellt sich nur die Frage wie viele Museen schafft man in einem Urlaub? Wie viele Besuche sind nötig, um Seite für Seite aus dem Buch zu besuchen? Denn eines steht fest: Man will sie alle sehen!