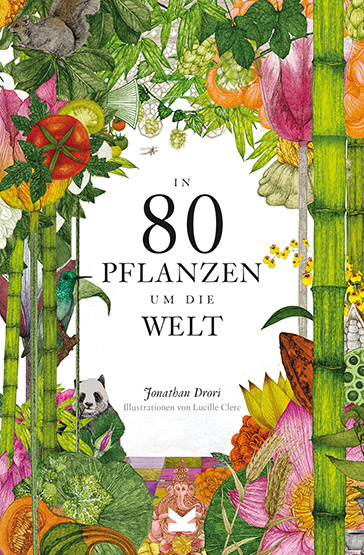Wenn ein Kind quengelt, dass es partout nicht ins Bett gehen will, kann das schon mal die letzten Nerven kosten. Wenn Pavarotti „Nessun dorma“ schmettert, trauert man der verlorenen Zeit nach, in der man dieses Lied nicht gehört hat. Italienisch ist nun mal die Sprache der Musik. Und Sizilianisch? Das ist keine eigenständige Sprache, sondern ein Dialekt, der – bereist man Sizilien – hier und da so manche Tür öffnen kann und einen geselligen Abend durchaus erleichtert.
Mit diesem kleinen Büchlein, das bequem in jede Hosentasche passt, ohne dabei zu stören, trägt richtig dick auf. Beginnen wir am Ende des Buches, das man so schnell nicht aus der Hand legen wird. Hier befindet sich ein kleines Wörterbuch. Allerdings nicht für Deutsch und Sizilianisch, sondern für Italienisch und Sizilianisch. Hier werden die Unterschiede, aber vor allem die Gemeinsamkeiten deutlich.
Für die richtige Aussprache muss man weiter nach vorn blättern. Die richtige Aussprache der Buchstaben – die gleichen wie im Deutschen – sorgen die ersten Seiten. Sobald folgen gelehrige Einführungen in die Grammatik, was schlimmer klingt als es dann doch ist. Jeder sizilianische Satz wird Wort für Wort (liest sich erstmal seltsam, hilft aber enorm beim Verständnis für den Aufbau der Sprache) übersetzt. Darunter steht die deutsche Entsprechung. „Ich zu trinken Wasser“ (Lu a vìviri acqua) – da denkt man, dass man sich verhört hat. So spricht doch keiner. „Ich muss Wasser trinken“ – so klingt der Satz verständlich für deutsche Ohren. Hat man sich daran gewöhnt, kann man im Handumdrehen selbst Sätze bilden.
Ein wenig Vorbildung im italienischen Wortschatz ist von Vorteil, wenn man sich dem Dialekt Siziliens nähert.
Wie immer, wenn man beginnt eine neue Sprache zu lernen (auch wenn es sich um einen Dialekt handelt), muss man sich eine gesunde Basis schaffen. So wie man den Tag mit dem Frühstück beginnt – auch wenn das im Speziellen in Sizilien nicht gerade üblich ist, hier schaufelt man sich erst zum Mittag die Backen richtig voll, um am späten Abend ein nicht minder reichhaltiges Mahl zu genießen, was das wegfallende Frühstück wiederum erklärt – so beginnt auch dieses Buch mit ein paar wenigen essentiellen Vokabeln und leichteren Grammatikregeln. Zahlen, Wochentage, wiederkehrende Floskeln erleichtern den Einstieg ins noch fremde Sizilianisch. Kapitel für Kapitel wird man sicherer im Umgang mit Aussprache und Wörtern, so dass man dann und wann schon mal den ersten Flirt auf Sizilianisch probieren kann. Eine Erfolgsgarantie ist das nicht, aber gegenüber den Anderen hat man zumindest den Vorteil der gemeinsamen sprachlichen Ebene auf seiner Seite. Es lohnt sich also dieses kleine Büchlein zu sutdieren…