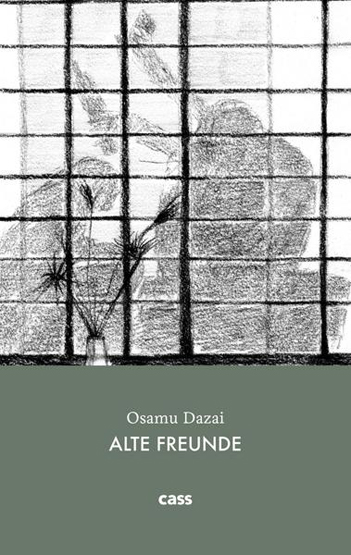Es wird immer noch gern das Klischee gepflegt, dass Künstler arm sein müssen, um kreativ sein zu können. Bei Jules Verne kann, ja, muss man dieses Vorurteil mit einem Handstreich beiseite wischen. Den goldenen Löffel hatte er zwar nicht im Mund bei seiner Geburt 1828, jedoch erlaubten es die Einkünfte des Anwalts Pierre Verne, seines Vaters, der Familie finanziell sorgenfrei leben zu können.
Die Nähe zum Atlantik, Jules Verne wurde in Nantes geboren, war es dann wohl auch, die dem späteren Autor seinen Hang zu den Weltmeeren schriftstellerisch Ausdruck verleihen konnte. Als zehnjähriger war er einmal auf einer kleinen vorgelagerten Insel ein kleiner Robinson. Die Ebbe erlaubte es dem kleinen Jules jedoch klammen Fußes wieder nach Hause zu gelangen.
Paris sollte für Jules Verne die zweite Station seines erfolgreichen Lebens werden. Als Jurastudent genoss er das Leben in der französischen Hauptstadt, die für die meisten das Sprungbrett zu einer großen Karriere war. Doch es zog ihn zum Schreiben. Kunstkritiken – Gustave Courbet war einer seiner bevorzugten Maler, die er mit Genuss verriss – waren die ersten Gehversuche auf dem literarischen Feld. Er begegnete dem Verleger Pierre-Jules Hetzel, der als einer der ersten dem Beruf des Verlegers eine neue Dimension verlieh. In Zeitschriften fütterte er das Publikum an, um seine Bücher besser verlegen bzw. an den Leser zu bekommen. In Jules Verne erkannte er den idealen Partner. Wissenschaftliche Neugier und ebenso tiefgreifendes Verständnis, gepaart mit einem exzellenten Talent diese auch transportieren zu können – danach musst der Verleger von nun an nicht mehr suchen. Der Mythos Jules Verne schlug Wurzeln.
Die lagen von nun an aber in Amiens. Von hier aus – Jules Verne hatte sich auf einer Hochzeit unsterblich in eine junge Dame verliebt – hielt Verne Kontakt nach Nantes zu seiner Familie und nach Paris zu seinem Verleger. Es folgen die fetten Jahre. Schon der Erstling „Fünf Wochen im Ballon“ (der Titel wurde von Verleger Hetzel angepasst) ist ein Erfolg. „Die Reise zum Mittelpunkt der Erde“ (beträchtlich inspiriert von einem riesigen Aquarium auf der Weltausstellung und durch die Schriftstellerin George Sand befeuert) und „Die Reise um die Erde in 80 Tagen“ (als Theaterstück binnen kurzer Zeit hunderte Male aufgeführt) besiegeln den Ruhm Jules Vernes, der bis heute anhält. Privat hingegen lief es weniger gut. Jules Vernes Sohn Michel bereitete mit seiner renitenten Art dem Vater immer mehr und anhaltend Kopfzerbrechen, wie er seinem Verleger mitteilte.
Ralf Junkerjürgen gelingt es mit der Akribie seines Helden Jules Verne dem Leser eine Biographie vorzulegen, die es an Spannung und neuen Elementen mit dem Werk des Schriftstellers aufnehmen kann. Jules Verne wird bis heute als Vater der Science-fiction-Literatur bezeichnet. Dabei hat er „nur“ das verwendet, was sowieso schon vorhanden war. Er nutzte die technischen Errungenschaften der und wob sie in seine Abenteuergeschichten ein. Schreckensszenarien waren der Zeit geschuldet und waren keineswegs rein Utopien. So wie diese Biographie. Ralf Junkerjürgen hat unzählige Fakten zusammengetragen und sie mit dem Werk Vernes verknüpft. So manche Episode aus Robur, geheimnisvollen Inseln und mutigen Kapitänen sind der damaligen Realität entlehnt. Sie zu erkennen ist von nun an ein Kinderspiel.