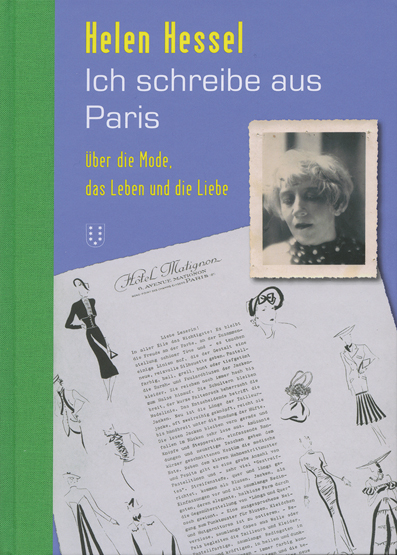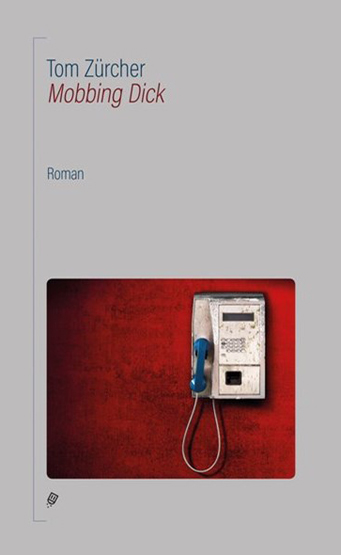Das Tagwerk ist geschafft, nun winkt endlich der ersehnte Schlaf. Doch das Erlebte lässt einen nicht mehr los. Es arbeitet im Hirn auf Hochtouren. An Schlaf ist da nicht mehr zu denken. Als alt bewährtes Mittel hilft da Schäfchenzählen. Ein Schaf, zwei Schafe, hilft nichts. Diese wolligen Biester lassen einen auch nicht einschlafen. Das ist gemein.
Klar, denn, was man da zählt sind GemeinSchafe. Die blöken nicht nur, sie falten Papier und schnipsen es im hohen Bogen gegen alles, was nicht schnell genug ausweichen kann. Und dann lachen sie einen auch noch aus. Moment. Hier läuft doch was schief! Nein, hier läuft gar nichts schief!
Anna Derndörfer haben es die Schafe angetan. Vierundzwanzig Geschichten bringt sie in diesem (durchaus auch als Einschlaflektüre geeignet, obwohl die Geschichten überhaupt nicht einschläfernd sind) Buch an den Sch(l)afenden.
Noch gemeiner als das GemeinSchaf ist das LebensgemeinSchaf. Mutter- und VaterSchaf hingegen sind liebevoller.
Wer beim Titel auf erfolgversprechende Einschlafgeschichten hofft, wird schon bald eines Besseren belehrt werden. Denn es sind wirklich Geschichten von Schafen. Schafe, die einem das Leben erschweren, aber auch erleichtern können. Man kann sie zählen, aber wenn man sich dann an die gelesenen Geschichten erinnert, muss man automatisch loslachen. Also wieder kein Schlaf!
Doch, doch. Jede einzelne Geschichte – man steigt doch ziemlich schnell dahinter, dass die Schafe nur allzu menschliche Züge haben – eignet sich ebenfalls als Gute-Nacht-Geschichte. Das liegt in erster Linie an der Länge bzw. Kürze der Geschichten, zum Anderen aber vor allem an der Leichtigkeit der Worte. Die Schwere des Tages verliert sich in den Zeilen wie die Schafe im Frühjahr sich ihrer Haarpracht entledigen. Mal muss man innehalten, mal sich den Bauch vor Lachen.