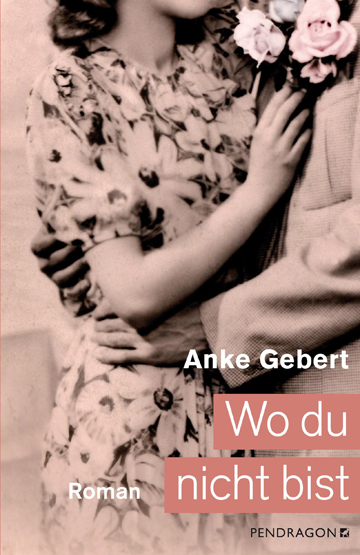Noch ein Buch zu hundert Jahren Frauenwahlrecht? Nein, ganz bestimmt nicht! Obwohl es mit Wahl und Frauen zu tun hat. Aber ganz anders, als so mancher es vermuten mag…
Was macht ein PR-Heini, wenn es ihm zu bunt wird? Er geht zum Psychologen. Der hilft, so wie er jedem hilft, der zu ihm kommt. Man selbst muss nur aktiv werden. Proaktiv, überhaupt aktiv. Nicht reagieren. Bloß nicht das! Doch wenn der Seelenklempner keine Hilfe ist? Was dann? Dann wird es richtig spannend! Im Falle von Frank Stremmer entwickelt sich alles zu einem Spiel, einer Wette. Und Christoph Höhtker ist der Strippenzieher im Hintergrund. Lasset die Spiele beginnen! ADORA QUOD INCENDISTI, INCENDE QUOD ADORASTI! Bete an, was Du verbrannt hast. Verbrenne, was du angebetet hast!
Besagter Frank Stremmer beginnt das Jahr auf der Couch seines Psychologen. Gelangweilt ob der belanglosen Fragestunde wirft Stremmer den Vorsatz in den Raum in diesem Jahr monatlich eine Frau zu verbrauchen. Einfach nur so! Prostitution ist dabei ausgeschlossen. Als Anreiz soll das Vorhaben – endlich hat der Patient mal einen Plan, scheint der Doc sich zu denken – als Wette getarnt sein. Der Doc darf sich was aussuchen, wenn er gewinnt. Stremmer setzt als Einsatz seinen Selbstmord. Sich jetzt schon Gedanken zu machen, wer gewinnt, wäre lächerlich. Denn noch stehen zwölf aufregende Monate – mit, für Stremmer, hoffentlich zwölf aufregenden „Verbrauchs-Frauen“ – ins Haus.
Ohne überhaupt eine Antwort von Yves Niederegger, seinem Psychoklempner, abzuwarten, macht sich Frank Stremmer an die Arbeit. Im Januar soll die Auserwählte über ein Dating-Portal ausfindig gemacht werden. Malin, Künstlerin aus Zürich, klingt ganz ansprechend. Alles ohne Zwang, aufregend, anregend – so soll es sein. So passiert es. Mit dem Zug von Genf nach Zürich, alles hinter sich bringen und wieder zurück in die eigene graue Gruft, die nur durch das Bildschirmflimmern des Laptops ein wenig Farbe erhält. Ein Zwölftel ist geschafft. Das Zweite bringt Frank auch ohne Verluste hinter sich. Es läuft. Sechzehn Komma sechs Periode Sechs Prozent schon geschafft. Doch der sportliche Ehrgeiz ist es nicht, der Frank Stremmer antreibt. Es gibt nichts auf dieser Welt, das ihn antreibt. Außer sein Chef, dessen Ego durch seine Arbeit als PR-Mann gelobt, gehypt, gewürdigt sein soll. Hat dieser Typ wirklich die Macht Frank Stremmer am Leben zu erhalten? Wenn ja, dann sollte das niemals an Frank Stremmers Ohren gelangen! Denn in Frank Stremmers Welt ist er allein für seine Situation verantwortlich. Und ein bisschen gefällt er sich auch in dieser Rolle. So kann er beweisen, dass er doch noch zu was zu gebrauchen ist…
Dieses Buch als Anleitung zu Frauenaufreißen oder als Legitimation zur zügellosen Verantwortungslosigkeit zu betrachten, wäre fatal. Denn die Frauen sind nur Beiwerk. In Wahrheit sucht Frank Stremmer gar nicht nach Frauen, sondern nach sich selbst und seinem Leben einen wahren Sinn zu geben. Dass dabei auch der eine oder andere Lustgewinn für ihn abfällt, nimmt er hin wie ein Mann.