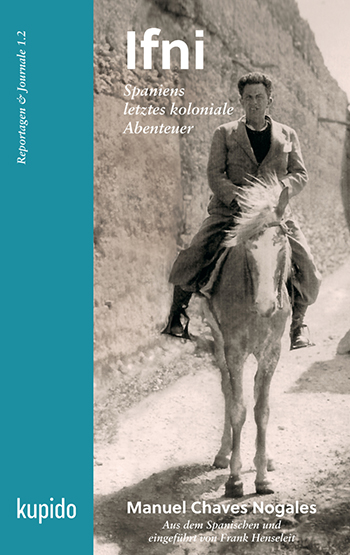Eine der unzähligen widerwärtigen Seiten des Krieges ist die Namenlosigkeit der Täter. Die Opfer und deren Angehörige wissen nicht, wem sie die Schuld geben können. Die wenigen namentlich bekannten Täter bekommen so eine Bedeutung, die ihrer Gewissenlosigkeit eine Bedeutung angedeihen lässt, die sie niemals verdienen.
Und passt es ins Bild, dass eine namenlose junge Frau, Palästinenserin, von einem Vorfall liest, der exakt ein Vierteljahrhundert vor ihrer eigenen Geburt stattgefunden hat. Israels Soldaten patrouillieren an der frischen Grenze, um potentielle Angreifern, Gegnern, Saboteuren, Feinden Einhalt gebieten zu können. Dabei greifen sie auch eine junge Frau auf. Tage später ist sie tot. Gefangen genommen, gedemütigt, geschlagen, vergewaltigt, ermordet. Im Namen … ja, im Namen von wem, von was? Die Frau hatte einen Namen, die Täter auch. Dennoch liegen ihre Gesichter im Schatten der Geschichte.
Die junge Palästinenserin, der das Datum des Todes dieser jungen Frau (und dabei spielt es überhaupt keine Rolle woher sie kam, welche Nationalität sie gehabt hat) so nahe geht, macht sich auf die Suche nach den Begebenheiten, die damals geschahen. Sie will nicht anklagen, Opfersteine errichten oder Gerechtigkeit erwirken. Sie ist persönlich an dieser Geschichte interessiert. Und das nur wegen dieses Datums: 13. August 1974.
Sie bricht auf, um eine Reise zu tun, die sich verändern wird. Checkpoints in und um Ramallah erschweren ihr ein ungehindertes Weiterkommen. Immer im Gepäck: Die Angst bei ihrer vermeintlich illegalen, zumindest sich unerwünschten, Recherche aufzufliegen. Und im Kopf rattern die Gedanken in Lichtgeschwindigkeit. Immer sind es die kleinen Dinge, die ihr auffallen. Schon oft ist ihr ein Detail eher ins Auge gestochen als das große Ganze. Warum nur? Warum passiert ihr das immer?
Adania Shibli wurde 1974 in Palästina geboren. Die Parallelen zu der namenlosen Frau in ihrem Buch treten offen zutage. Vielleicht ist sie selbst diese Frau, in Grundzügen sicherlich. Beim Lesen wird einem immer wieder bewusst, dass ein Krieg niemals mit der Unterschrift unter einem Vertrag beendet ist. Er ist niemals zu Ende. Auch wenn die Hoffnung stiftende Spruch, dass Menschen und nicht Kanonen töten, sie sind es ja schließlich auch, die ihn beginnen.
Es kann Gras über eine Sache wachsen. Doch was folgt ist immer wieder Gras. Es wird immer wachsen. Im Anbetracht der aktuellen Lage in Osteuropa erlangt dieses Buch eine Bedeutung, die über die Grenzen Israels, Palästinas und der Region hinausgeht. Es bleibt allein die Hoffnung, dass auch durch dieses Buch so manches Auge weiter geöffnet wird.