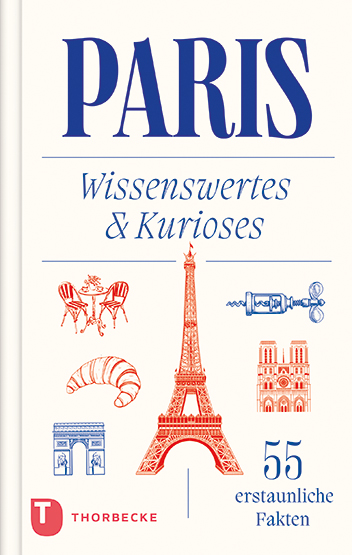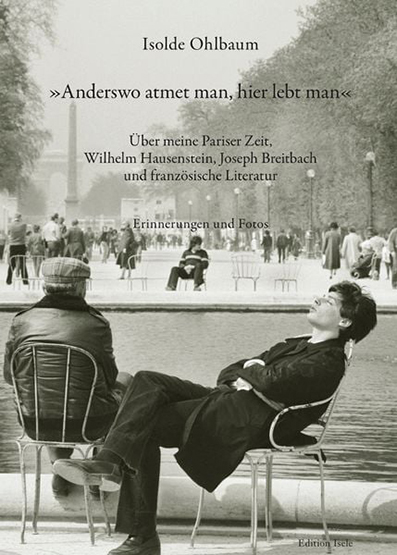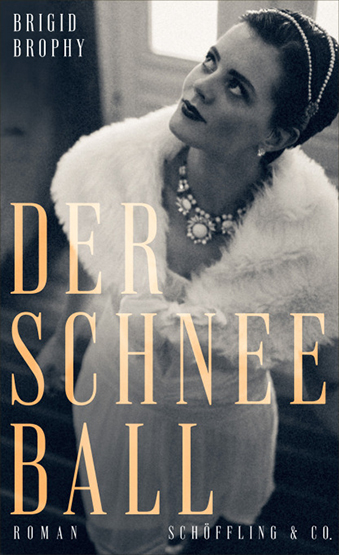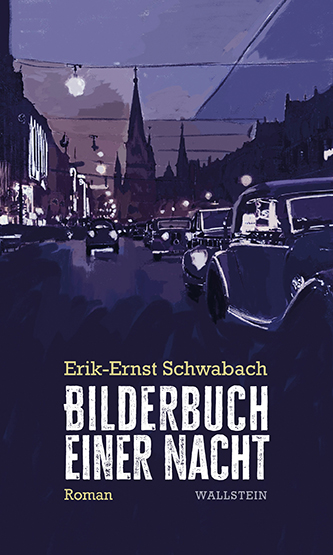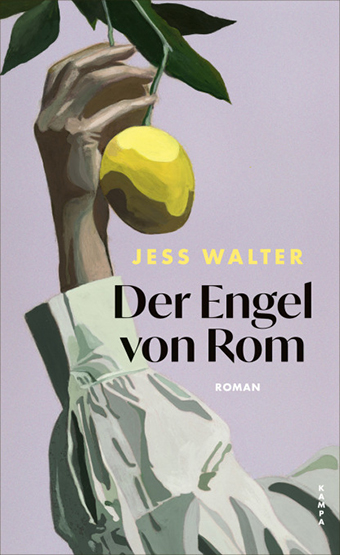Wer mit Informationen voll ausgestattet nach Paris reisen will, muss fürs Extragepäck zahlen. Die Flut an Büchern ist schier unendlich. Und verständlich! Schließlich will man diese faszinierende Stadt auch mit allen Sinnen und komplett aufsaugen. Aber ganz ehrlich: Das ist unmöglich mit einer Reise zu schaffen, auch wenn das Verkehrssystem in Paris es rein zeitlich zulassen würde.
Seit einigen Jahren ist es chic sich mit dem Rad fortzubewegen. Dafür stehen tausende Leihräder zur Verfügung. Aber auch rund zehn Prozent davon müssen täglich(!) repariert werden. Und rund fünf Prozent werden erst gar nicht wieder zurückgegeben.
Weitaus berühmter ist die Metro und ihre kunstvoll gestalteten Metrostationen. Dabei galten sie vor einhundert Jahren, als man begann sie im Jugendstil zu errichten als altmodisch. Apropos Mode. Paris ohne Mode? Geht nicht. Den Grundstein dafür legte übrigens ein … Engländer.
Fünfundfünfzig Fakten, die nicht zwingend erforderlich sind, um Paris zu erkunden, jedoch jeden Spaziergang zu einem besonderen Erlebnis machen, sind in diesem Leichtgewicht versammelt. Es passt in jede Tasche, ist dank des Harteinbandes schnell zur Hand und sorgt Seite für Seite für ein Aha oder Oh lala. Das reicht vom Baguette (die Entstehungsgeschichte ist spannender als man denkt) über Geisterbahnhöfe bis hin zu Fakten, die ein wenig von der überbordenden Pracht der Stadt ablenken (für diejenigen, die ab und zu doch mal zu viel von der Schönheit der Stadt bekommen).
Die liebe volle und ansprechende Gestaltung des Buches führt dazu, dass man es immer wieder aus der Tasche zieht und sich mit scheinbaren Nebensächlichkeiten den Rundgang versüßt. Manchmal erschrickt man doch: Paris ohne Eiffelturm. Das war mal der Plan. Er sollte kurz nach der Weltausstellung 1889 abgerissen werden. Raten Sie mal wie hoch wäre der Stahlrest, wenn er auf der Grundfläche zusammengeschmolzen zur Besichtigung angeboten wäre! Es ist weniger als man denkt…
In diesem Buch hingegen steckt mehr als es das Ausmaß des Buches vermuten lässt.